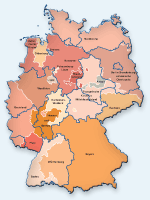Texte zum Schwerpunktthema: Mission
4. Tagung der 9. Synode der EKD (7.-12. November 1999, Leipzig)
Referat zur Einführung in das Schwerpunktthema
Prof. Dr. Eberhard Jüngel

Herr Präses, hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder!
Als mich Präses Schmude mit der ihm eigenen Überredungskunst - zwar nicht mit "groß' Macht", aber doch "mit viel List" - dazu bestimmte, das "Referat zur Einführung in das Schwerpunktthema" zu übernehmen, da ahnte ich nicht, worauf ich mich eingelassen hatte. Ich hatte nicht bedacht, dass es sich bei dem Thema "Mission und Evangelisation" zwar um eine ganz elementare Eigenart, um eine konstitutive Grundstruktur der christlichen Kirche handelt, dass aber dieses Einfachste überaus komplex ist: Missverständnisse provozierend, ja Ärgernis erregend - und das, obwohl die Füße derer, die evangelisieren, nach Jes 53,1 und Röm 10,15 doch ausgesprochen liebliche Füße sein sollen. Als ich dann begriff, worauf ich mich eingelassen hatte, wurde mir klar, dass ich kaum mit einem mehr oder weniger akademischen Referat, sondern eher mit einer pastoralen Meditation dem Schwerpunktthema gerecht werden könnte. Ich bitte Sie also, mit mir gemeinsam zu meditieren, was es mit der der Christenheit aufgetragenen Mission und Evangelisation auf sich hat. Meditation im reformatorischen Sinn heißt freilich nicht: Augen zu und in sich hinein! Es geht vielmehr darum, etwas genauer als üblich hinzusehen und nachdenklich zu werden.
Das soll in acht Schritten geschehen. Zuerst soll auf eine peinliche Lücke in der Lehre von der Kirche (I), sodann auf eine missverständliche Praxis (II) hingewiesen werden. Dann soll als Voraussetzung von Mission und Evangelisation die Tatsache gewürdigt werden, dass die Welt - wohlgemerkt: nicht nur die Kirche, sondern die ganze Welt - bereits im Licht der Gnade existiert (III), um anschließend auf terminologische Probleme einzugehen (IV). Ein fünfter Schritt gilt dem Ziel von Evangelisation und Mission: der Welt sollen die Augen aufgehen (V). Wie man das macht, der Welt die Augen zu öffnen, das soll unter der Überschrift "Werben um die Welt: die theologische Kultur der Bejahung" bedacht werden (VI). Danach soll in Erinnerung gerufen werden, dass der Adressat aller Evangelisation und Mission das menschliche Ich und doch zugleich mehr als nur dieses ist (VII). Und schließlich soll die Aufmerksamkeit darauf gerichtet werden, dass es neben der primär direkten und unmittelbaren Evangelisation auch so etwas wie eine indirekte, mittelbare und dennoch ansprechende Bezeugung des Evangeliums gibt (VIII).
I. Eine ekklesiologische Lücke.
Wenn die Kirche ein Herz hätte, ein Herz, das noch schlägt, dann würden Evangelisation und Mission den Rhythmus des Herzens der Kirche in hohem Maße bestimmen. Und Defizite bei der missionarischen Tätigkeit der christlichen Kirche, Mängel bei ihrem evangelizzesthai würden sofort zu schweren Herzrhythmusstörungen führen. Der Kreislauf des kirchlichen Lebens würde hypotonisch werden. Wer an einem gesunden Kreislauf des kirchlichen Lebens interessiert ist, muss deshalb auch an Mission und Evangelisation interessiert sein. Weithin ist die ausgesprochen missionarische Arbeit zur Spezialität eines ganz bestimmten Frömmigkeitsstils geworden. Nichts gegen die auf diesem Felde bisher besonders engagierten Gruppen, nichts gegen wirklich charismatische Prediger! Doch wenn Mission und Evangelisation nicht Sache der ganzen Kirche ist oder wieder wird, dann ist etwas mit dem Herzschlag der Kirche nicht in Ordnung.
Wenn die Christenheit atmen könnte, wenn sie Luft holen und tief durchatmen könnte, dann würde auch sie erfahren, dass "im Atemholen ... zweierlei Gnaden" sind. Sie würde beides, das Einatmens-Müssen und das Ausatmens-Können als eine Gnade erfahren, ohne die sie nicht leben könnte. Einatmend geht die Kirche in sich, ausatmend geht sie aus sich heraus. Die Bibel redet von Gottes Geist nicht selten wie von einem Wind oder einem Lufthauch, den man einatmen kann und von dem die Kirche erfüllt sein muss, um geistlich leben zu können. Die Kirche muss mit diesem geistlichen Atemzug in sich gehen, um sich als Kirche stets aufs Neue aufzubauen. Das tut sie vor allem in ihren liturgischen Gottesdiensten. Da ist sie um Gottes Wort und um den Tisch des Herrn versammelt, da ist sie gesammelt und konzentriert bei sich selbst. Doch wenn die gottesdienstlich versammelten "Glaubigen, bei welchen das Evangelium rein geprediget und die heiligen Sakrament lauts des Evangelii gereicht werden" (CA VII), wenn die als Gemeinde versammelten Christen den durch Gottes Wort und Sakrament vermittelten Geist Gottes (CA V) nur für sich selber haben wollten, von ihm gar Besitz ergreifen, ihn nostrifizieren wollten, so würden sie an dieser göttlichen Gabe regelrecht ersticken. Im Atemholen sind nun einmal zweierlei Gnaden. Die Kirche muss, wenn sie am Leben bleiben will, auch ausatmen können. Sie muss über sich selbst hinausgehen, wenn sie die Kirche Jesu Christi bleiben will. Sie kann als die von seinem Geist bewegte Kirche nicht existieren, wenn sie nicht auch missionierende und evangelisierende Kirche ist oder wieder wird.
Eigentlich müssten sich Mission und Evangelisation für die christliche Kirche also von selbst verstehen. Eigentlich müssten da, wo auch nur zwei oder drei im Namen Jesu Christi versammelt sind, diese zwei oder drei intensiv und leidenschaftlich darauf aus sein, dass alsbald vier oder fünf und immer noch mehr Menschen im Namen Jesu Christi zusammenkommen. Denn das ungeheure Ereignis, von dem wir herkommen und das uns zu Christenmenschen gemacht hat, das will mit uns über uns hinaus. Was Friedrich Nietzsche vom Tode Gottes als dem angeblich größten neueren Ereignis behauptet hat, das gilt in Wahrheit vom Tode dessen, der für alle Menschen gestorben und um ihrer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist: "Dies ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und wandert".1 Und ein Christ ist von allen anderen Menschen dadurch unterschieden, er ist vor aller Welt dadurch ausgezeichnet, dass er darauf hinzuweisen, dass er dies zu bezeugen hat: der Gekreuzigte und Auferstandene ist noch unterwegs und wandert. Eigentlich müsste dieses die Geschichte der Welt wendende Ereignis in aller Welt Munde sein. Eigentlich ...
Wenn sich in unserer Welt irgendwo etwas Unerhörtes, etwas überaus Bedeutsames, aber in keiner Weise zu Erwartendes ereignet, etwas, was die Welt grundlegend verändert - so, dass sie aus den Fugen zu geraten droht -, dann redet auch alle Welt davon. In unserer Mediengesellschaft zumal. Als vor zehn Jahren hier in Leipzig von der Nicolai-Kirche aus die angeblich sozialistische Welt tatsächlich aus den Fugen zu geraten begann und als in der Folge dieser Vorgänge dann in Berlin die Mauer fiel, da wurde sofort nicht nur der ganzen Stadt, sondern der Stadt und dem Erdkreis, da wurde urbi et orbi davon Zeugnis gegeben. Selbst im entlegendsten Winkel Amerikas, in den ich mich damals verirrt hatte, war die Rede von Leipzig und Berlin. Damals war, wovon man allenfalls zu träumen wagte, wahr geworden. Und obwohl sich alsbald neue Lebenslügen einstellten, war das in der Tat zumindest für eine Stunde die Stunde der Wahrheit: der Wahrheit, die freimacht. Und von der alle Welt redete. Das war vor zehn Jahren. Und heute?
Heute haben wir uns an das, was damals eine unerhörte Wahrheit war, längst gewöhnt. Sie ist selbstverständlich geworden. Uns aber beschäftigen nur noch die problematischen Folgen jener Stunde befreiender Wahrheit. Nichts ist für eine große lebendige Wahrheit tödlicher als die Gewöhnung.
War es eine allzu schnelle Gewöhnung an das wiederentdeckte Evangelium, war es allzu schnelle Gewöhnung an die reine Predigt des Evangeliums und die dem Evangelium gemäße Feier der Sakramente, was die klassische protestantische Lehre von der Kirche schon in der Reformationszeit und danach erst recht dazu verführte, eine schier unüberschreitbare Grenze zwischen Kirche und Welt zu ziehen und die Kirche so zu definieren, "dass die Existenz der Kirche ... und die ihrer Glieder das Endziel der Wege Gottes"2 zu sein schien? Wie konnte man, wenn man das Neue Testament ernst nahm, auch nur in der Theorie, nämlich bei der Definition der Kirche, darüber hinwegsehen, dass das sie konstituierende Evangelium nicht nur der Kirche, sondern aller Welt gilt, folglich also auch die als Kreatur des Evangeliums existierende Kirche schlechterdings kein Selbstzweck sein kann, sondern in die Welt hinaus muss, um dieser von ihr (noch) unterschiedenen Welt im recht verstandenen Sinne des Wortes Bescheid zu sagen, über Gott und die Welt Bescheid zu sagen? War es Gewöhnung oder war es gar ein ganz und gar nicht heiliger Egoismus, der die Kirche veranlasste, ihr Selbstverständnis unter penetranter Absehung von der Welt so zu formulieren, als bilde "das Ganze in Jesus Christus geschehene ... Heilsgeschehen auf der einen - und das Dasein ... der Kirche auf der anderen Seite einen in sich geschlossenen Kreis, eine vollkommene Welt für sich inmitten der übrigen sehr unvollkommenen Welt"3? Karl Barth hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass jenes die positive Beziehung zur Welt ausblendende Selbstverständnis der Kirche etwas zu tun hat mit der die ältere protestantische Kirche kennzeichnenden "ausgesprochene[n] Unfreudigkeit, ja Unwilligkeit zur Mission"4.
Das änderte sich allerdings zumindest in der Praxis mit der sonst theologisch so oft geschmähten "Moderne", in der vor allem der Pietismus, aber doch auch die Aufklärung jene Bewegung in die Kirche brachten, die die Christen veranlasste, wieder missionarisch und evangelisierend tätig zu werden. In der Lehre von der Kirche beginnt sich allerdings erst in unseren Tagen jene Lücke zu schließen, die in der überlieferten Ekklesiologie unübersehbar klaffte. Die sechste Barmer These, der gemäß es zu den Konstitutiva der Kirche gehört, die Botschaft von der freien Gnade Gottes allem Volk zu überbringen, wartet noch immer auf ihre ekklesiologische Rezeption. Und vielleicht ist es dieser prinzipielle ekklesiologische Mangel, der den in der Neuzeit ausgebrochenen missionarischen Eifer innerhalb der Kirche immer wieder zu ersticken droht. Ohne eine entsprechende theologische Selbstkorrektur läuft auch die Praxis immer wieder Gefahr, an dem unzureichenden Selbstverständnis der Kirche zu scheitern. Diese Gefahr droht noch immer, droht bis auf den heutigen Tag. Denn es lässt sich ja nicht bestreiten, dass trotz des leidenschaftlichen missionarischen Engagements der neuzeitlichen Christenheit und trotz beachtlicher evangelistischer Tätigkeiten schon die Ausdrücke Mission und Evangelisation immer wieder unter Verdacht geraten. Was macht sie - zumindest im einstmals christlichen Abendland - so verdächtig? Offensichtlich gibt es nicht nur einen theoretischen Mangel in der Lehre von der Kirche, sondern auch eine theologische Schieflage in der missionarischen Praxis.
II. Missverständliche Praxis.
Mission, Evangelisation? Rette sich, wer kann! So höre ich schon alle diejenigen rufen, die mit beiden Begriffen nur einen Schematismus der Frömmigkeit zu assoziieren vermögen: einen Schematismus, der die Kinder der bunten Welt zwar in Kinder des Lichtes zu verwandeln verspricht, sie zu diesem Zwecke aber erst einmal als Kinder der Finsternis identifizieren muss: einer Finsternis, wie sie finsterer nicht gedacht werden kann; einer Finsternis, die so dunkel ist, dass die angestrebte Verwandlung der ihr verfallenen Menschen in Kinder des Lichtes den weiten Weg bis zum reinen Licht gar nicht zu bewältigen vermag, sondern irgendwo in der Mitte zwischen beiden Extremen, bei einem scheinbar frommen, in Wahrheit aber nur elend tristen Grau in Grau endet. Mission und Evangelisation - beide Ausdrücke werden von vielen Nichtchristen und sehr viel häufiger noch auch von Christen als Schlagwörter gefürchtet, hinter denen sich eine Praxis verbergen soll, die auf eine religiöse Uniformierung hinausläuft: jeder missionierte Mensch hat da nichts anderes zu sagen als jeder andere missionierte Mensch; jedes evangelisierte Ich gleicht dem anderen evangelisierten Ich wie ein Ei dem anderen. In immer denselben formelhaften Wendungen kommt das bekehrte Ich auf seine Bekehrung zurück, so dass Evangelisation auf Indoktrination hinauszulaufen droht und Mission auf die Transformation der reichen Individualität eines menschlichen Ich in ein stereotypes Es. Aus Ich soll Es werden, aus einem buntscheckigen weltlichen Ich ein frommes aber graues, ein graues, aber frommes Es - dergleichen fürchtet offensichtlich eine nicht geringe Zahl derer, die mit den Wörtern Mission und Evangelisation nur noch Klischees zu verbinden vermögen und deshalb, statt sich retten zu lassen, wenn sie so etwas wie Mission und Evangelisation auch nur von ferne zu wittern meinen, die Gegenparole ausgeben: rette sich, wer kann!
Das aber kann niemand. Denn Rettung im christlichen Sinne des Wortes, das ist des Menschen Errettung und Befreiung aus seiner selbstverschuldeten Gottesferne und aus den sie begleitenden Lebenslügen - hin zu einem gelingenden Leben mit Gott: zu einem Leben, das wahres Leben genannt zu werden verdient. Die Befreiung zum wahren Leben und also des Menschen Rettung ist aber ein exklusiv göttliches Werk. Sauve qui peut: Rette sich, wer kann? Gott allein kann retten. "Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren".
Das werden vermutlich auch diejenigen nicht bestreiten wollen, die christliche Mission und Evangelisation für eine höchst problematische Angelegenheit halten. Ich weiß nicht, welchen Erfahrungen ihre Bedenken entstammen. Ich bin meinerseits evangelisierenden Christenmenschen begegnet, denen die referierten Klischees bitteres Unrecht zufügen. Ich habe gelegentlich mit missionierenden und evangelisierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Kirche theologisch gemeinsam gearbeitet und kann nur mit großem Respekt an diese Begegnungen zurückdenken.
Aber ich bin eben auch solchen Menschen begegnet, die bei den Versuchen, sie als Kinder einer heillosen Finsternis zu identifizieren, um sie sodann in das rettende Licht zu versetzen, zwar ihre Buntheit verloren, doch statt dessen in der Tat nur eben grau geworden sind.
Das aber ist nun so ziemlich das Gegenteil dessen, was mit den beiden Wörtern Mission und Evangelisation ursprünglich angezeigt wurde und was mit den derart angezeigten christlichen Aktivitäten ursprünglich intendiert war. "Jedem Worte klingt der Ursprung nach, dem es sich herbedingt" hat Goethe behauptet. Das gilt auch für die uns beschäftigenden Termini Mission und Evangelisation. Mit Hilfe der biblischen Texte können wir die ursprüngliche Bedeutung und Funktion beider Wörter recht genau zurückgewinnen. Und wenn das gelingt, dann wird sich zeigen, dass durch recht verstandene Mission und recht verstandene Evangelisation schlechterdings kein Grau in Grau erzeugt werden kann, sondern ganz im Gegenteil jenes herrliche Farbenspiel entsteht, in dem sich die Gnade Gottes spiegelt, die nach 1Petr 4,10 bekanntlich ausgesprochen bunt ist.
Gewiss, das Neue Testament unterscheidet selber messerscharf zwischen den Glaubenden als Kindern des Lichtes und den Nichtglaubenden als Kindern der Finsternis (vgl. 1Thess 5,5; Joh 8,12; 12,36.40; Lk 16,8). Doch es lohnt sich, der biblischen Lichtmetaphorik auf den Grund zu gehen.
III. Die Welt im Licht der Gnade.
Geht man der biblischen Lichtmetaphorik auf den Grund, dann erscheint der messerscharfe Gegensatz zwischen Licht und Finsternis noch einmal in einem neuen, in einem ganz ungewohnten Licht. Denn "Kinder des Lichtes" sind die Glaubenden deshalb, weil sie "Kinder des Tages" sind. Paulus gebraucht beide Ausdrücke mit Bedacht parallel (1Thess 5,5). Er setzt dabei allerdings voraus, dass die Nacht im Schwinden ist, und zwar deshalb im Schwinden ist, weil ein neuer Tag, ein nicht mehr endender Tag im Kommen, unwiderruflich im Kommen ist (vgl. Röm 13,12). Und dieser Tag, auf den keine Nacht mehr folgt, ist eben deshalb unwiderruflich im Kommen, weil (so formuliert es das Johannesevangelium) in der Person Jesu Christi "das Licht der Welt" (Joh 8,12; 9,5) zu uns gekommen ist (Joh 1,9; 12,46): das wahre Licht (Joh 1,9), das Licht, das Leben zu erzeugen verspricht.
Dieses Licht ist nun da. Es bringt die Nacht zum Schwinden, und zwar ohne dass ein Mensch dabei mitwirkt - so wie ja auch im natürlichen Rhythmus der Welt der Tag ohne unsere Mitwirkung der Nacht ein Ende macht. Wenn aber die Sonne aufgeht, dann geht sie über Gute und Böse auf, dann geht sie allen auf (vgl. Matth 5,45). Und nun ist es überaus erregend, dass nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums in strenger Analogie zu der allen Menschen aufgehenden Sonne Jesus Christus das nicht nur den Glaubenden, sondern das allen Menschen leuchtende Licht ist: "Er war das wahrhaftige Licht, das jedem Menschen leuchtet" (Joh 1,9).
Das ist der souveräne Indikativ des Evangeliums: dass die ganze Welt bereits im Lichte der Gnade Gottes existiert, dass also auch der noch nicht "missionierte", dass auch der noch nicht "evangelisierte" Mensch bereits vom Licht des Lebens erhellt wird. Ist dieses Licht schon da, dann ist es für alle da. Bricht der Tag schon an, dann bricht er für alle an. Der Apostel (Röm 10,20f.) zitiert den Propheten Jesaja (65,1f.), um diesen souveränen Indikativ herauszustellen: Jahwe erklärt dort: "Ich war zugänglich für die, die nicht nach mir fragten; ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten; zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sprach ich: da bin ich, da bin ich!" In Jesus Christus spricht Gott so zu allen Völkern, zur ganzen Welt, also auch zu den sogenannten "Kindern der Finsternis": da bin ich, ich bin da. Das Licht des Lebens ist da, es ist für alle da. Es ist also nicht so, dass unsere evangelisierende Tätigkeit das Licht des Lebens allererst erzeugt. Sie hat nur eben auf das schon scheinende Licht hinzuweisen, es anzuzeigen. Ganz bestimmte, den Adressaten der Evangelisation regelrecht bearbeitende Praktiken verbieten sich damit ganz von selbst. Ein missionarischer Hammer ist ein Unding. Der Apostel Paulus wendet sich als Bittender an die Welt, wenn er sie auf den Indikativ des Evangeliums anspricht. Wer bittet, hämmert nicht. Viel Takt, viel weltlicher und geistlicher Takt ist erforderlich, wenn Mission gelingen soll.
Allererst von diesem mit der Geschichte Jesu Christi identischen souveränen Indikativ des Evangeliums her werden dann auch die Imperative verständlich, die die Glaubenden auffordern, nun ihrerseits zu leben und tätig zu werden "als Kinder des Lichtes" (Eph 5,8; vgl. Röm 13,12f.; 1Thess 5,5ff.). Doch zwischen diese ethischen Imperative und jenem souveränen Indikativ schiebt sich sozusagen ein Zwischenglied, in dem Indikativ und Imperativ ganz dicht beieinander sind. Und in diesem "Zwischenglied" zwischen jenem souveränen Indikativ des Evangeliums einerseits und den unsere Aktivitäten herausfordernden Imperativen andererseits hat das, was zu Recht Mission und Evangelisation genannt zu werden verdient, seinen theologischen Sitz im Leben.
Da gilt einerseits: die Glaubenden leuchten nun ihrerseits einfach dadurch, dass sie als Glaubende da sind wie Lichter (Phil 2,15). Ja sie sind nach Matth 5,14 sogar - im Vergleich mit der Selbstprädikation des johanneischen Christus (Joh 8,12; 12,46) eigentlich eine Ungeheuerlichkeit! - "das Licht der Welt". Aber sie sind das, weil bereits in ihrer christlichen Existenz zur Darstellung kommt, was sie dann auch anderen Menschen eigens zu verkündigen aufgefordert werden. Und so sind sie andererseits die von Gott Beanspruchten, die unter seinem Befehl, seinem Imperativ Stehenden. Denn genau das, was die Glaubenden indikativisch durch ihr bloßes Dasein als Glaubende bereits bezeugen, das sollen sie nun auch noch eigens verkündigen. Dazu nämlich hat nach 1Petr 2,9 Gott Euch zum "auserwählten Geschlecht", zur "königlichen Priesterschaft", zum "heiligen Volk" gemacht, "damit Ihr die Wohltaten dessen verkündigen sollt, der Euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat". Wer vor diesem Licht, obwohl er sogar mit Worten auf es hingewiesen wurde, erneut die Augen schließt, der bleibt in der Finsternis, in der selbstverschuldeten Finsternis. Er bleibt aber nur deshalb in der Finsternis, weil er in ihr bleiben will.
Doch warum muss, was doch als Indikativ bereits weltweites Aufsehen erzeugen müsste, noch eigens verkündigt werden? Warum muss auf das in die Finsternis gekommene Licht noch eigens hingewiesen werden? Warum muss die Christenheit missionarisch, evangelistisch tätig werden?
Bevor wir diese Frage zu beantworten versuchen, dürfte es allerdings angebracht sein, auf die terminologischen Probleme einzugehen, die mit den Ausdrücken Mission und Evangelisation zweifellos verbunden sind.
IV. Zur Terminologie.
Mission und Evangelisation: beide Begriffe sind biblischen Ursprungs. Missio heißt Sendung. Evangelisieren bedeutet nichts anderes als das Evangelium verkündigen. Die missio geschieht um des evangelizzesthai willen, das seinerseits aufgrund von missio geschieht. Auf Griechisch heißt der Gesandte der Apostel. Der ursprüngliche Gesandte, nämlich der von Gott in die Welt Gesandte, ist Jesus Christus, der im Hebräerbrief auch ausdrücklich apostolos genannt wird (Heb 3,1). Dass er nicht im eigenen Namen redet und wirkt, sondern, als die Zeit erfüllt war, von Gott in die Welt gesandt wurde (Gal 4,4), wird insbesondere im Johannesevangelium stark herausgestellt (vgl. Joh 3,17; 5,36f.; 6,29.57; 8,28f. u.ö.). Doch genauso, wie er von Gott gesendet worden ist, sendet Jesus Christus die Seinen in die Welt (Joh 17,18; 20,21). Als von den Toten Auferweckter hat er seinerseits ursprüngliche, authentische Gesandte, nämlich die Apostel. Als Gesandte weisen sie zurück auf den, den sie vertreten. Sie vertreten ihn aber mit einer Botschaft, sind also als Gesandte zugleich Botschafter, nämlich Botschafter des Evangeliums.
Diese Botschaftertätigkeit der Apostel setzt die evangelisierende Kirche fort. Wo immer das Evangelium sachgemäß - und das heißt seit dem Entstehen des neutestamentlichen Kanons schriftgemäß - verkündet wird ("pure docetur" - CA VII), wo also evangelisiert wird, da (und nur da) ereignet sich apostolische Sukzession. Im Zusammenhang der kirchlichen Lebensvollzüge weist der Ausdruck Mission also darauf hin, dass die Kirche sich nicht im eigenen Namen und in eigener Autorität an die Welt wendet, wenn sie ihr das Evangelium bekannt macht, sondern dass sie das als Gesandtschaft Jesu Christi tut, der alle Glaubenden dazu autorisiert, als seine Botschafter tätig zu werden.
Im neuen Sprachgebrauch hat man dann unter Evangelisation "die Ausrichtung der Botschaft in der näheren Umgebung der Gemeinde"5 verstanden. Insbesondere wird so dasjenige Evangelisieren genannt, das sich an die vom Evangelium bereits irgendwie Erreichten, aber offensichtlich von ihm noch nicht oder nicht mehr Überzeugten, ihm noch nicht oder nicht mehr Glaubenden wendet. Evangelisation wendet sich an die - paradox formuliert - "nichtchristliche Christenheit", sie dient der "Erweckung" der "schlafenden Kirche"6. Mission meint im neueren Sprachgebrauch hingegen zunächst die über die mehr oder weniger christliche Umwelt hinausgehende Ausrichtung der christlichen Botschaft an die nichtchristliche, an die heidnische Welt. Doch die Rede von der inneren Mission macht deutlich, das der Ausdruck auch das abdecken kann, was man im modernen Sprachgebrauch Evangelisation zu nennen pflegt. Angesichts dieses unklaren Sprachgebrauches empfiehlt es sich, die ursprüngliche Bedeutung der Ausdrücke wach zu halten.
Eine besondere und neuerdings besonders heftig umstrittene Frage geht dahin, ob auch der im Neuen Testament eindeutig bezeugte Apostolat an die Juden Mission genannt werden soll. Setzt man den neueren Sprachgebrauch voraus, so ist der Ausdruck Mission für die Botschaft, die die Christen auch den Juden nicht vorenthalten dürfen, ein ausgesprochen problematischer Terminus. Und der Begriff "Judenmission" ist einfach deshalb nicht nur ein unglücklicher, sondern ein gänzlich unbrauchbarer Begriff, weil er das Volk Israel mit den Heidenchristen zu parallelisieren droht. Er verkennt, dass der Gott, der seinen Sohn in die Welt gesandt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Er verkennt, dass das Heil von den Juden stammt (Joh 4,22) und dass Israels Berufung unwiderruflich ist (Röm 11,29). Er verkennt, dass die aus den Heidenvölkern berufenen Christen als wilde Schösslinge dem edlen Ölbaum Israel eingepfropft worden sind (Röm 11,17f.). Nur als solche können sie sich Israel gegenüber bemerkbar machen mit der Botschaft, dass der aus dem Geschlechte Davids geborene Jesus von Nazareth durch seine Auferweckung von den Toten als Gottes Sohn eingesetzt, definiert worden ist (Röm 1,3f.): "Christ, der Retter ist da!" Diese Wahrheit darf allerdings niemandem vorenthalten, muss also auch Israel gegenüber angezeigt werden. Aus der Bezeugung des Evangeliums in Israel ist ja die Kirche hervorgegangen. Sie müsste ihre eigene Herkunft verleugnen, wenn sie das Evangelium ausgerechnet Israel gegenüber verschweigen wollte. Dass das Evangelium Israels ureigenste Wahrheit ist, daran zu erinnern haben die Apostel sich verpflichtet gewusst. Aus dieser Verpflichtung kann auch die Kirche nicht entlassen werden. Das ist allerdings etwas ganz anderes, als der Versuch von Christen, "Juden auf den christlichen Glauben [zu] verpflichten" (vgl. epd vom 9. November 1999, 6). Ihren apostolischen Auftrag kann die Kirche nur so erfüllen, dass dabei als Ziel aller Wege Gottes nicht etwa eine triumphierende Kirche in Betracht kommt, sondern dies, "dass ganz Israel gerettet werde" (Röm 11,26). Die himmlische Polis, zu der sich auch das wandernde Gottesvolk der Christen unterwegs weiß, heißt denn auch nicht etwa Athen und schon gar nicht Rom oder gar Wittenberg, sondern Jerusalem. In dieser Polis wird es dann allerdings weder einen jüdischen Tempel noch eine christliche Kirche geben.
Muss noch eigens ausgesprochen werden, dass wir Deutsche die denkbar schlechtesten Botschafter gegenüber Israel wären? Nachdem die Kirche in Deutschland, als es bitter nötig war, nicht für die Juden geschrieen hat, wird sie schon aus der ihr gebotenen Strenge gegen sich selbst heraus sich für ganz und gar unberufen halten, Israel im Namen Jesu Christi anzusprechen. Doch aus demselben Grund wird sie sich eben auch zu hüten haben, ihr eigenes Unvermögen den Christen und Kirchen in aller Welt zu unterstellen. Dass wir Deutsche zu schweigen haben, bedeutet mitnichten, dass die christliche Ökumene nichts zu sagen hätte. Auch sie hat hier allerdings nur insofern etwas zu sagen, als sie mit Israel gemeinsam auf Gottes Wort hört.
Dem Hören auf Gottes Wort verdankt sich jede Evangelisation, also auch die evangelisierende und missionierende Tätigkeit der Christen gegenüber der heidnischen Welt. Wir müssen nun allerdings auf die schon gestellte Frage zurückkommen, warum das Hören in ein Reden und ein ihm entsprechendes Handeln übergehen muss. Warum also muss die Christenheit überhaupt missionarisch und evangelisierend tätig werden?
V. Der Welt die Augen öffnen.
Eigens verkündigt werden muss die neue Wirklichkeit deshalb, weil der unwiderruflich kommende Tag erst im Anbrechen ist, so dass man noch die Augen davor verschließen kann, dass die Nacht schon im Schwinden ist. Die Verkündigung soll der selbstverschuldeten Unfähigkeit, die Augen zu öffnen, ein Ende machen. Das fromme Lied übertreibt zwar etwas, wenn es behauptet: "Denn das ist die größte Plage, wenn bei Tage, man das Licht nicht sehen kann". Doch das ist wahr, dass die ungläubige Welt trotz des Beginns des Tages noch immer in die Nacht verliebt ist. Ihr müssen die Augen geöffnet werden für das, was kommt. Evangelisation heißt also: aus Nichtsehenden Sehende zu machen. "Sehet, was Ihr hört" - mit diesem - im Protestantismus weitgehend vergessenen - Imperativ hatte schon der irdische Jesus seinen Jüngern die weltlichen Sinne für das geschärft, was der geistliche Sinn seiner Sendung war: Sehet, was Ihr hört (Mk 4,24). Der auferstandene Christus hat auf seine Weise allen Völkern dieselbe Zielbestimmung gegeben: ihnen sollen die Augen geöffnet werden für das, was in seiner Geschichte geschehen ist. Von seiner Geschichte geht - mit Hölderlin zu reden - "allerneueste Klarheit" aus. Unsere immer unübersichtlicher werdende Welt wird dann zwar nicht einfach problemlos. Es ist dann nicht einfach auf einmal - wie es in der Reklamesprache heißt - "alles klar". Wahrhaftig nicht! Aber es entstehen Durchblicke, ungewöhnliche Durchblicke, die Orientierung gewähren: Orientierung von oben her für das Leben ganz unten. Dafür gilt es evangelisierend die Augen zu öffnen.
Die Augen sollen allerdings mit Hilfe von menschlichen Worten geöffnet werden - so wie ja auch eine Mutter ihrem Kind eigens sagen kann: sieh - sieh, wie schön! oder: sieh genau hin! Oder wie der Dichter die von ihm Ansprechbaren mit Worten zum Sehen bewegt: "Komm in den totgesagten Park und schau ...". Die Sprache kommt den Augen zu Hilfe. Deshalb endet das Matthäusevangelium (28,19f.) mit der missio, der Sendung der Jünger, die allen Völkern durch ihre Worte die Augen öffnen und sie auf diese Weise ebenfalls zu Jüngern machen und taufen sollen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Und sodann sollen die, die schon Jünger sind, denen, die Jünger werden, alles zu halten lehren, was Christus geboten hat. Nicht nur für das, was Gott schon, und zwar ganz allein getan hat, sondern auch für das, was von uns zu tun ist, müssen der Menschheit offensichtlich erst die Augen geöffnet werden. Zur Evangelisation gehört auch die Erinnerung an die Zehn Gebote. Das, was da zu tun geboten wird, ist zwar oft das Selbstverständlichste von der Welt. Aber gerade das, was sich eigentlich von selbst verstehen sollte, sehen wir nicht oder kaum oder selten.
Noch ein Wort zur theologischen Eigenart des Missionsbefehls des Auferstandenen! Dass der Befehl, zu missionieren, von dem ausgeht, der von sich selber sagt "Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden" (Matth 28,18), macht deutlich, dass der Missionsbefehl im Grunde eine unerhörte Auszeichnung ist. Denn der, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, der ist auf unsere menschliche Mitwirkung ja wahrhaftig nicht angewiesen. Er könnte unmittelbar wirken, sozusagen "senkrecht von oben". Will er gleichwohl, dass Menschen anderen Menschen bezeugen, wer er ist, dann ist das eine unerhörte Würdigung, eine Auszeichnung des Menschen: wir werden dessen gewürdigt, Mitarbeiter Gottes, sunergoˆ qeoà, zu sein (1Kor 3,9). Was der Apostel von sich und Apollon behauptet, das gilt nach Luther für alle Christenmenschen. Wir, die wir zu unserem eigenen Heil schlechterdings nichts beitragen, die wir für unser Zusammensein mit Gott schlechterdings nichts tun können, wir dürfen bei der Bezeugung und Verkündigung des Heils mit Gott zusammenwirken: "So hat es Gott gefallen" - schreibt Luther - "dass er nicht ohne das Wort, sondern durch das Wort den [ewiges Leben mit sich bringenden] Geist austeilt, auf dass er uns zu seinem Mitarbeitern habe: "Sic placitum est Deo, ut non sine verbo, sed per verbum tribuat spiritum, ut nos habeat suos cooperatores ..." 7
Halten wir fest: Evangelisieren heißt auf jeden Fall: mit Hilfe des Wortes etwas sehen lassen. Nein, nicht nur etwas, sondern das, was gesehen zu haben sich zeitlich und ewig lohnt.
Was sieht man da? Die Antwort ist von elementarer Einfachheit. "Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen" (Apk 21,3)! Das also sieht man: dass Gott mit den Menschen zusammenkommen, zusammensein und zusammenleben will. Wo dieser göttliche Wille sich vollzieht, wo er sich erfüllt, da entsteht Kirche. Doch die Kirche hat, indem sie entsteht, nun ihrerseits alle Welt sehen zu lassen, dass Gott mit allen Menschen zusammenkommen, zusammensein und zusammenleben will. Die Kirche ist "der Ort in der Welt, an der dieser die Augen über sich selbst aufgehen"8. Der von der Kirche noch unterschiedenen Welt nun ihrerseits dazu zu verhelfen, dass ihr die Augen über sich selbst aufgehen - das ist der Sinn, das ist die Funktion und Intention dessen, was man Mission und Evangelisation zu nennen pflegt: nämlich der Welt zu verstehen zu geben, dass Gott mit ihr zusammenkommen, mit ihr zusammensein und zusammenleben will.
Wie macht man das?
VI. Werben um die Welt: die theologische Kultur der Bejahung.
Wie macht es denn ein menschliches Ich, wenn es mit einem anderen menschlichen Ich zusammenkommen, zusammensein und zusammenleben will?
Mitunter genügt, um dem anderen Menschen den eigenen Wunsch zu verstehen zu geben, schon ein Blick, freilich ein ganz besonderer Blick, ein werbender Augen-Blick, und doch von Tiefe: so tief, dass er der anderen Person zu Herzen geht und ihr dort, im Zentrum ihrer Existenz, dann ein Licht aufgeht.
Mitunter ist es auch eine körperliche Berührung, die dann dem derart affizierten anderen Menschen das Bekenntnis entlockt: "Wenn ich in deine Augen seh, dann schwindet all mein Leid und Weh. Und wenn ich küsse deinen Mund, dann werd ich ganz und gar gesund".
Oft tut auch eine Einladung zu Brot und Wein das ihre. Zusammen Essen und Trinken ist ja eine besonders intensive Weise des Zusammenlebens. Das ist übrigens auch am Rande des "akademischen Lebens" der Fall. Insbesondere aber, wenn das Leben festlich wird: dann steigern Brot und Wein die Gemeinschaft, das gemeinsame Leben.
Nicht selten schreibt man auch einen Brief und hofft, dass er dem Empfänger ebenso zu Herzen geht wie ein liebevoller Blick. Am häufigsten aber ist es ein mündliches, ein ansprechendes Wort, mit dem Wille und Wunsch zum Zusammensein und Zusammenleben zum Ausdruck gebracht werden.
Doch diese zweifellos weltlichen Lebensvorgänge sind zugleich Gleichnisse für das geistliche Geschehen von Mission und Evangelisation. Im Neuen Testament stehen sie für verschiedene Möglichkeiten, mit denen Gott uns zu verstehen gibt, dass er mit dem ganzen menschlichen Geschlecht und mit jedem einzelnen menschlichen Ich zusammenkommen, zusammensein und in Zeit und Ewigkeit zusammenleben will.
Dass er dies will, das glauben wir. Denn an Jesus Christus glauben heißt: an diejenige Person glauben, in der Gott und Mensch ein für alle mal zusammengekommen sind, damit Gott unseren Tod und wir sein Leben teilen können. Das ist das Geheimnis des Glaubens und als solches das Innerste der Kirche. Doch gerade dieses "ihr Innerstes drängt unwiderstehlich nach außen"9. Was in der Person Jesu Christi bereits für alle Menschen wahr geworden ist, das will und soll im Leben jedes Menschen Wirklichkeit werden und muss deshalb aller Welt nahe gebracht werden. Jesus selber hat das durchaus auch mit einem Blick versucht, freilich keineswegs immer mit Erfolg (wie die Geschichte vom reichen Jüngling zeigt: vgl. Mk 10,21).
Erfolgreicher war Jesus hingegen, wenn er Menschen berührte, um sie zu heilen, oder um sie von den sie beherrschenden Dämonen zu befreien und ihnen durch diese Art des Nahekommens zu verstehen zu geben, dass Gottes Reich nahe herbeigekommen ist. Auch durch solche heilenden Berührungen kann, das zeigen die synoptischen Heilungsperikopen, Glauben hervorgerufen werden. Freilich gab es auch in dieser Hinsicht Grenzen für ihn: in seiner Heimat, in Nazareth "konnte er kein einziges Wunder tun" (Mk 6,4f.).
Überaus bedeutsam war das gemeinsame Essen und Trinken, bei dem Jesus Gottes Willen zum Zusammensein mit gottvergessenen Menschen elementar vor Augen geführt hat.
Und nach der Auferstehung und Erhöhung Jesu Christi wurden dann Briefe geschrieben, apostolische Briefe. Doch der Apostel Paulus kennt nicht nur die mit Tinte geschriebene Post. Er kann auch die von ihm missionierte Gemeinde als einen für alle Menschen lesbaren Brief bezeichnen (2Kor 3,2f.). Man bedenke: ist die Gemeinde in ihrem Dasein bereits ein von allen Menschen lesbarer Brief, dann hat schon ihre Existenz eine missionarische Funktion.
Doch nach dem Zeugnis des Neuen Testaments ist es nun doch vor allem das ansprechende mündliche Wort, durch das in menschlichen Herzen ein Licht aufgehen soll, auf dass es zur Erkenntnis Jesu Christi komme (2Kor 4,6). Das aber ist eine Erkenntnis, die sich nicht primär aufgrund von mehr oder weniger gelehrten Diskursen einstellt. Die Erkenntnis Jesu Christi ist die Erkenntnis einer Wahrheit, die das Gewissen trifft - so trifft, dass ich mein Gewissen und im Gewissen mich selbst ganz neu entdecke. Und das ist stets eine doppelte Entdeckung.
Unweigerlich entdecke ich mich da als ein in Lebenslügen und Schuld verstricktes Ich. Denn "das Gewissen ist immer schlechtes Gewissen" (Luther). Schon deshalb wäre nichts verkehrter, als dem gottlosen Menschen allererst ein schlechtes Gewissen zu machen. Das kann die Aufgabe von Evangelisation und Mission auf keinen Fall sein. Sie hat vielmehr zur Erkenntnis Jesu Christi zu verhelfen. Und das ist die Erkenntnis einer Wahrheit, die frei macht (Joh 8,32). Trifft diese befreiende Erkenntnis das Gewissen, dann entdecke ich mich also nicht nur als ein Lebenslügen und in Schuld verstricktes Ich, sondern zugleich und erst recht als ein von aller Schuld und aus allen Lebenslügen befreites Ich, das dann für seine Befreiung nur dankbar sein kann und unendlich dankbar ist. Dankbarkeit aber bleibt nicht stumm. Habe ich das im Evangelium laut werdende Ja Gottes als ein mir ganz persönlich geltendes, mich befreiendes Ja vernommen, dann wird es zu einer dankbaren Antwort kommen: dann wird es zum Gebet kommen. Im Gebet wird die Freiheit zwingend, so bezwingend, dass das mit Gott zusammengekommene und mit ihm nun zusammenlebende Ich jetzt auch mit Gott zusammen reden will, zu ihm seinerseits Ja sagen will. Und das dürfte dann auch die Pointe aller missionarischen und evangelisierenden Tätigkeit sein: nämlich dem angesprochenen Ich zur Erkenntnis derjenigen Wahrheit zu verhelfen, die zeitlich und ewig frei macht und eben deshalb beten lehrt.
Das derart befreite Ich kann dann übrigens auch das Ausmaß und die Schwere seiner Schuldverstrickungen und Lebenslügen noch ganz anders ermessen als der darin Gefangene. Erst im Lichte der Wahrheit vermag man die Tiefe der Finsternis zu ermessen, der man verfallen war. Erst als von Gott gerechtfertigter und also bejahter Mensch erkenne ich die ganze Strenge des meine Sünde verurteilenden göttlichen Nein. Recht verstandene Evangelisation und Mission bringen dieses Nein aufgrund des göttlichen Ja zur Geltung. Und insofern setzen sie so etwas wie eine Kultur der Bejahung frei, deren elementarste Ausdruck das Gebet ist.
VII. Der Adressat: Ich und mehr als Ich.
Ich habe bisher und insbesondere mit den Ausführungen über die das Gewissen treffende Wahrheitserkenntnis herausgestellt, dass die der Welt das Evangelium bezeugende und also evangelisierende und missionierende Kirche sich dem menschlichen Ich zuwendet, sich ihm persönlich zuwendet, es höchst persönlich anspricht: so, dass es einen jeden derart Angesprochenen - mit Act 2,37 formuliert - "mitten durchs Herz geht". Insbesondere die evangelisierende Zuwendung zum Menschen wird in der Regel diese Zuspitzung haben. Aber auch die missionarische Tätigkeit wird das individuelle personale Moment nicht einfach überspringen können.
Doch das bisher Dargelegte wäre völlig missverstanden, wenn man es für so etwas wie einen christlichen Individualismus in Anspruch nehmen wollte. Eine individualistische Engführung von Evangelisation und Mission kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil das sich in seinem - in der Tat immer nur individuellen - Gewissen neu entdeckende Ich nicht in splended isolation existiert, sondern zur Gemeinschaft der Glaubenden befreit wird. Man wird aber nicht erst vom terminus ad quem, sondern schon vom terminus a quo her, man wird schon im Blick auf die für das Evangelium zu gewinnenden Adressaten des christlichen Zeugnisses nicht ignorieren dürfen, dass die evangelisierende Rede das einzelne Ich nur ernst nimmt, wenn sie es in seinem sozialen und kulturellen Kontext ernst nimmt. Und in diesem Kontext ist das einzelne Ich in der Regel immer ein Ich neben anderen und ein Ich in einem ganz bestimmten soziokulturellen Milieu. Selbst die Mitteilung der Apostelgeschichte, dass die apostolische Rede den Angesprochenen "mitten durchs Herz" gegangen sei, galt einer ganzen Gruppe von Menschen, die Petrus sogar als Repräsentanten des ganzen Hauses Israel angeredet hatte (Act2,36ff.). Evangelisation und Mission haben, auch und gerade wenn sie das einzelne Ich erreichen wollen, zugleich immer eine dieses Ich transzendierende, sagen wir einmal: soziokulturelle Zeugnisfunktion. Evangelisation und Mission werden deshalb, auch und gerade wenn sie sich direkt und unmittelbar dem Menschen zuwenden, zugleich immer eine indirekte und mittelbare Zeugnisfunktion haben. Zu ihrer personalen, den Menschen als virtuellen Christen und als designiertes Glied der Kirche ansprechenden Dimension gehört zugleich immer auch eine säkulare, die Welt als Welt ansprechende Dimension.
Bei der einst sogenannten äußeren Mission liegt das ja auf der Hand. Sie wendete sich zwar ebenfalls an das einzelne Ich, sprach dieses aber in der Regel als Glied seiner Gruppe, seines Clans, seines Stammes oder seines Volkes an. Mutatis mutandis wiederholte sich hier, was im Urchristentum geschah, wenn der pater familias "mit seinem ganzen Haus" getauft wurde. Gruppenbezogene Mission hat zudem so etwas wie einen ganzheitlichen Aspekt. Denn zur Ganzheit eines Menschen gehört zweifellos auch seine soziokulturelle Umwelt. Jesu harte Forderung, dass man Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und sogar sich selbst hassen müsse, wenn man sein Jünger werden will (Lk 14,26), macht zwar deutlich, dass das Evangelium alle Plausibilitäten und auch alle bisherigen Bindungen in die Krisis führt, also auch die bisherigen sozialen und kulturellen Kontexte. Aber auch das Verhältnis des Menschen zu sich selbst gerät hier in eine elementare Krisis. Doch Krisis heißt nicht Zerstörung. Und aus einer solchen Krisis geht niemals ein von allen gesellschaftlichen Bezügen isoliertes Ich hervor. Jesu hartes Wort, dem seine Absage an die eigene Familie (Mk 3,33-35) korrespondiert, setzt zudem das von ihm mehrfach in Erinnerung gerufene (vgl. Mk 7,10; 10,19) Gebot, Vater und Mutter zu ehren, keineswegs außer Kraft. Evangelisation hat ganz gewiss die private Sphäre ernst zu nehmen, aber immer auch zu transzendieren. Sie geschieht publice. Sie ist öffentliche Rede, und zwar nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch für die Öffentlichkeit, die durch das Evangelium gleichfalls angesprochen und herausgefordert - in bestimmten Fällen regelrecht provoziert - werden muss. Wer missioniert, hat ernst zu nehmen, dass das anzusprechende Ich in einem Ensemble gesellschaftlicher, kultureller, sozialer, politischer Verhältnisse existiert. Ja, er hat sogar den bisherigen religiösen Kontext des anzusprechenden Menschen zu respektieren - dies freilich so, dass ihm von seinem bisherigen religiösen Kontext mit Anstand Abschied zu nehmen ermöglicht wird. Hermeneutischer Leitsatz dürfte für die hier entstehenden Probleme die Auskunft des Apostels Paulus sein, dass er um des Evangeliums willen den Juden ein Jude geworden ist, um Juden zu gewinnen, und ebenso den ohne Gesetz lebenden Heiden ein Heide geworden ist, "damit ich auf alle Weise einige rette" (1Kor 9,19-23).
Die im Zusammenhang mit der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts entstandenen überaus verdienstvollen europäischen Missionsgesellschaften haben freilich oft eher genau umgekehrt den Menschen jener anderen Weltgegenden, die sie missionieren wollten, zugemutet, nun ihrerseits den Europäern ein Europäer zu werden. "Konzeptionell wurde in der Missionsarbeit häufig europäische Zivilisation und Evangelisierung allzu sehr gleichgesetzt" - konstatiert das (übrigens in jeder Hinsicht überaus lesenwerte) Votum des theologischen Ausschusses der Arnoldshainer Konferenz (1999, S.33) zu Recht. Die Kritik an jener missionarischen Praxis ist freilich seit langem in aller Welt Munde und droht ihrerseits mit negativen Pauschalurteilen die unbestreitbar positiven weltlichen Früchte jener geistlichen Arbeit zu bagatellisieren. Das apostrophierte Votum erinnert zum Beispiel daran, dass damals in nicht wenigen außereuropäischen Ländern "die Grundlagen für ein modernes Bildungs- und Gesundheitssystem" gelegt wurden. Nicht wenige Politiker aus den einst missionierten Ländern sind denn auch den Missionsgesellschaften dankbar verbunden geblieben - ein Tatbestand, den sich sogar die international noch nicht anerkannte DDR zunutze zu machen verstand: der Besuch hochrangiger Repräsentanten afrikanischer Staaten bei der in Ostberlin residierenden Berliner Missionsgesellschaft wurde nur zu gern als eine Art Staatsbesuch mit Anerkennungseffekt vereinnahmt.
Diese komplexe Problematik der sogenannten äußeren Mission macht deutlich, was deren Ziel nicht sein kann. Es kann nicht um die Ausbreitung des eigenen Denk- und Lebensstils - auch nicht des jeweiligen kirchlichen Denk- und Lebensstils! - gehen und schon gar nicht um einen kirchlichen Sukkurs für außenpolitische Interessen. Es kann aber auch nicht um kirchenpolitische Einflussnahme und schon gar nicht um die Erweiterung konfessioneller Machtpositionen gehen. Der missionarische Ruf ruft zur Gemeinschaft mit Jesus Christus und nur insofern auch in die kirchliche Gemeinschaft. Das wird dann konkret immer irgendeine konfessionell geprägte kirchliche Gemeinschaft sein. Aber diese kann sich schlechterdings nicht als Konkurrentin anderer kirchlicher Gemeinschaften verstehen, der man missionarische Erfolge missgönnt. Versteht sie sich dennoch so, ist sie in der missionarischen Arbeit fehl am Platz. Die Mission der Zukunft wird ökumenisch orientiert sein müssen oder sie wird überhaupt nicht mehr sein. Und zu dieser Ökumenizität der Mission gehört nicht zuletzt die Intention, die durch Mission entstehenden neuen Gemeinden ihrerseits als missionarische Subjekte ökumenisch ernst zu nehmen, sie also von jeder abhängig machenden Bindung zu befreien. "Man kann etwas zugespitzt sagen: der Sinn der Mission besteht darin, durch Begründung neuer, von den vormaligen Heiden selbst zu tragender Mission sich selber überflüssig zu machen." 10
VIII. Ansprechende Indirektheit.
Zum Schluss unserer - weiß Gott nicht alle Dimensionen auslotenden - Meditation über Mission und Evangelisation möchte ich noch hinweisen auf eine unbestreitbar wirksame, aber nicht direkt und unmittelbar, sondern indirekt und mittelbar wirksame Weise, das Evangelium an den Mann und an die Frau - und ihre Kinder! - zu bringen und zugleich dasselbe Evangelium auch der Gesellschaft zu bezeugen, in der sie existieren. Das mag zwar ungewöhnlich erscheinen, sollte aber dennoch nicht unterschlagen werden.
Ich beschränke mich dabei auf unsere eigene mitteleuropäische Situation, die allerdings eine in jeder Hinsicht nach Mission und Evangelisation geradezu schreiende Situation ist. In den neuen Bundesländern liegt das offen zutage. Weitgehend fehlen hier ja selbst die elementarsten Kenntnisse über das Christentum und seine Geschichte und die durch das Christentum geprägte Kultur - von katechetischem Wissen ganz zu schweigen. Doch man täusche sich nicht: auch in den alten Bundesländern haben wir es je länger je mehr mit einer Gesellschaft zu tun, die ihre christliche Herkunft immer mehr vergisst und eben deshalb die Kirche gebieterisch herausfordert, in ihrer allernächsten Umgebung evangelisierend wirksam zu werden. Und da sollte man das, was ich indirekte Evangelisation nennen möchte und was die alte Kirche unter der Kategorie der praeparatio evangelii subsumierte, auf keinen Fall verachten. Worum handelt es sich?
Da sind zunächst die der christlichen Gemeinde ureigenen Funktionen und die dazugehörenden Örter zu nennen, die von der nichtchristlichen Umgebung zunächst nur einfach wahrgenommen werden, die aber für sie in irgendeiner Weise "attraktiv" werden können und de facto auch immer wieder "attraktiv" werden. Ich beschränke mich auf einige, leicht zu vermehrende Hinweise.
Da ist zunächst und vor allem das Gotteslob, das unweigerlich erklingt, wenn die Christen als christliche Gemeinde zusammenkommen, das aber auch am Tisch einer christlichen Familie laut zu werden vermag. Ich erinnere mich an den unvergesslichen Tag bald nach dem Fall der Mauer, an dem ich von Tübingen aus in Magdeburg bei meinen zwar getauften, aber der Kirche doch recht entfremdeten Geschwistern eintraf. Ein mir befreundeter Assistent hatte mich, einen der Bedienung des Lenkrades schlechterdings Unfähigen, zusammen mit seiner Frau und seinen zwei kleinen Knaben in die Heimat chauffiert. Als wir dann abends zu Tische saßen und gemeinsam essen und trinken wollten, fingen die beiden Knaben mit ihren strahlenden Stimmen, als sei es ganz selbstverständlich, zu singen an: "Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt o Gott von dir. Wir danken dir dafür." Meine religiös eher unmusikalischen Schwestern haben mir später immer wieder erzählt, wie sehr sie dieses für sie spontane, für die Knaben aber ganz selbstverständliche Gotteslob bewegt hat. Es hat sie zum Einstimmen bewegt. Da habe ich begriffen, dass das Gotteslob der Christen "eine im Leben der Welt klaffende Lücke auszufüllen"11 hat. Das gilt für jede Form von Gotteslob! Nicht nur die Werke der unbestreitbar großen soli Deo gloria komponierenden musikalischen Genies, sondern eben auch das en famille ertönende und von den am Familientisch platznehmenden Atheisten wahrnehmbare Gotteslob hat eine zwar nur indirekt wirksame, aber doch nicht zu unterschätzende evangelisierende Funktion: übrigens eine Evangelisation ohne jede missionarische Absicht, aber vielleicht gerade deshalb mit einem nicht abzuschätzenden missionarischen Effekt. Im Gotteslob schwingt die Welt über sich hinaus. Im Gotteslob kann der sonst durchweg auf sich selbst bezogene Mensch über sich hinaus kommen. Eben deshalb gehört das Loben Gottes nicht nur in die Kirche, sondern genauso in die Öffentlichkeit der Welt. Und gegebenenfalls müssen die Kirchenräume selber zu solcher weltlichen Öffentlichkeit werden.
Und dann sind da die christlichen Schulen. In den neuen Bundesländern kann man ihre Bedeutung gar nicht hoch genug veranschlagen. Als ich vor einigen Monaten in Magdeburg in einem Taxi mit der Chauffeurin ins Gespräch kam und mich als evangelischer Pfarrer zu erkennen gab, reagierte sie sehr temperamentvoll: "Ich selbst", sagte sie, "bin ja eine hartgesottene Atheistin. Aber meinen Sohn schicke ich trotzdem auf das Ökumenische Gymnasium. Denn da lernt er zur Zeit am besten, was man über die Welt wissen muss. Und vielleicht lernt er auch etwas über den mir unbekannten Gott. Sei's drum!" Das Konto des Ökumenischen Gymnasiums Magdeburg lautet übrigens 166 30 62 bei der Volksbank Magdeburg (BLZ 810 932 74).
In einer gewissen Nachbarschaft zu den christlichen Schulen existieren die evangelischen Akademien. Auch in ihnen geschieht, und zwar wiederum ohne jede missionarische Absicht, so etwas wie indirekte Evangelisation. Eine Repräsentantin des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat mir - sogar mehrfach - erzählt, wie auf Veranstaltungen von evangelischen Akademien Prozesse des Nachdenkens ausgelöst worden sind: nicht nur über die jeweils verhandelten aktuellen Probleme, sondern auch über den Ort, an dem man mit der anderen Seite, also mit den Bossen, in einem sonst selten anzutreffenden Klima, nämlich mitten im Streit friedlich miteinander umgehen konnte; Schalom!
Der Ort kann auch, zumindest indirekt evangelisieren. Ein hochgelehrter Wissenschaftler, ursprünglich katholisch sozialisiert, aber seitdem seiner Kirche überaus entfremdet, erzählte mir vor wenigen Tagen, dass er, wenn er dann doch einmal in eine - durch ihr mystisches Dunkel gekennzeichnete - franziskanische Kirche geriete, ihn eine Aura umfinge, die ihn im Blick auf seine religiöse Entfremdung - ich sage es in meinen Worten - überaus nachdenklich mache. Für uns Protestanten sind Franziskanerkirchen mit ihrem seltsamen Dunkel wohl eher suspekt. Aber die große christliche Architektur in allen ihren Variationen ist noch immer ein zwar stummes, aber in ihrer Stummheit sehr wohl ansprechendes Zeugnis des Evangeliums.
Eine ebenfalls indirekte, aber überaus eindrückliche Erinnerung an das Evangelium ist der erste Satz unseres Grundgesetzes: "Die Würde des Menschen ist unantastbar". Der Satz ist eine Konsequenz des Glaubensartikels von der Rechtfertigung des Gottlosen. Denn dieser Glaubensartikel besagt, dass jeder Mensch, also nicht nur der Christ, eine von Gott definitiv anerkannte Person ist, deren Würde unantastbar ist. Wer sie verletzt, greift Gott selber an. Wer das begreift, mehr noch: wer das erfährt, der hat etwas vom Evangelium erfahren, auch wenn er noch gar nicht weiß, dass er da mit dem Evangelium Bekanntschaft gemacht hat.
Ganz anders orientiert sind die christlichen Werke, also alles das, was man als Diakonie zu bezeichnen pflegt. Wir sollten heute, nach so viel überaus schiefen Antithesen, darüber nun wirklich nicht mehr streiten, dass auch jede samaritanische Tat eine indirekte Bezeugung des Evangeliums ist: sie ist es gerade deshalb, weil sie gar nichts anderes im Sinn hat, als dem hilfsbedürftigen Nächsten zu helfen. Das Evangelium selber kann überaus selbstlos sein.
Und dann ist da noch der Sonntag, die christliche Variante des Sabbat, der Tag, der eigentlich an die Auferstehung Jesu Christi erinnern sollte, der aber auch einfach dadurch ein indirekter Zeuge des schöpferischen und sein gottloses Geschöpf rechtfertigenden Gottes ist, dass er den Rhythmus unseres tätigen, ständig auf Leistungen bedachten Lebens elementar unterbricht, so dass wir aus Leistungsmenschen wieder Seiende werden, staunende Seiende, die sich der unerhörten Tatsache freuen, dass sie überhaupt sind und nicht vielmehr nicht sind. Der Sonntag ist die temporale Gestalt der Rechtfertigungsbotschaft, also jenes Evangeliums, das uns darauf anspricht, dass wir mehr sind als die Summe unserer Taten und Leistungen - und natürlich erst recht mehr als die Summe unserer Untaten und Fehlleistungen. Eine sich für den Schutz des Sonntags einsetzende Kirche ist eine evangelisierende Kirche. Und sie sollte das nicht verschämt sein, sondern frei heraus: Wenn Gott selber den Sabbat brauchte, um von seinen Werken zu ruhen, um wie viel mehr braucht die Welt dann den Sonntag!
Last not least darf ich als Professor der Theologie auch auf das Dasein der theologischen Fakultäten innerhalb der Universität zu sprechen kommen. Wenn diese akademischen Institutionen ihrer Sache treu bleiben, dann haben auch sie eine zwar indirekte, in ihrer Indirektheit aber überaus ansprechende evangelisierende Wirkung. Noch sehr viel mehr als die staatlich abgesicherten theologischen Fakultäten hatten übrigens die kirchlichen Hochschulen in der ehemaligen DDR diese Funktion. Waren sie doch intellektuelle Oasen in einer ideologischen Wüste und eben deshalb selbst für Atheisten überaus attraktiv.
Lassen sie mich diese Ausführungen schließen mit einer Bemerkung zu meinem derzeitigen Lebenskontext. Ich habe zur Zeit das Privileg, als Fellow des Berliner Wissenschaftskollegs meinen theologischen Forschungen zur frönen. Zu den Pflichten der Fellows gehört das gemeinsame Essen. Da sitzt dann also der Theologe mit Kolleginnen und Kollegen unterschiedlichster Fakultäten zu Tische. Und wie es sich gehört plaudert man miteinander. Doch es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht auf meine theologische Existenz angesprochen werden, und zwar so angesprochen werde, dass mein Gegenüber mehr oder weniger deutlich von Ereignissen oder Problemen erzählt, die einen mitunter versteckten, mitunter offen zutage liegenden Bezug zu der Wahrheit haben, die ich als Theologe zu vertreten habe und gern vertrete. Ich werde dabei primär als Hörender in Anspruch genommen. Ich muss kaum etwas sagen. Und ich frage mich und frage sie, verehrte Zuhörer, ob es nicht auch so etwas wie eine Evangelisation durch aufmerksames, konzentriertes Zuhören gibt.
Das alles setzt allerdings voraus, dass es eine redende Kirche gibt, die sich des Evangeliums nicht schämt. Alle indirekte und mittelbare Evangelisation lebt davon, dass es die direkte und unmittelbare Bezeugung des Evangeliums gibt - wie ja auch der Mond nur zu scheinen vermag, weil es das Sonnenlicht gibt. Und so sollen und dürfen denn die gegebenen Hinweise auf das, was ich indirekte Evangelisation nannte, auf keinen Fall davon ablenken, dass - ich zitiere aus Luthers 95 Thesen gegen den Ablass - "der wahre Schatz der Kirche", nämlich "das hochheilige Evangelium", von der Kirche auf jede denkbare Weise in die Öffentlichkeit gebracht werden muss. Und das heißt für die Evangelische Kirche in Deutschland nun einmal zuerst und vor allem in die deutsche, religiös ausgehungerte Öffentlichkeit! Je ärmer, je geistlich ärmer sie ist, umso mehr hat die Welt ein heiliges Recht, hat sie einen ihr selbst zwar unbewussten, aber unabweisbaren Anspruch auf den wahren Schatz der Kirche. Und das liegt ja offen zutage, dass die deutsche Christenheit vor einer missionarischen Herausforderung steht, wie sie größer kaum gedacht werden kann.
Gewiss, diese Herausforderung anzunehmen bedeutet auch: sich strapazieren lassen. Mission ist nun einmal anstrengend. Noch dazu, wenn, um der Welt die Augen öffnen zu können, missionarischer Einfallsreichtum gefragt ist. Doch je mehr die Kirche evangelisierend und missionierend aus sich herausgeht, desto besser lernt sie dabei auch sich selber kennen. Docendo discimus - das gilt auch für das Reden von Gott in einer gottlosen Welt. Jeder Schritt in die weltliche Öffentlichkeit hinein macht die Kirche zugleich immer vertrauter noch mit ihrem ureigenen Geheimnis. Und so gehen denn der evangelisierenden Kirche bei dem Versuch, der Welt die Augen zu öffnen, erst recht die Augen über sich selber auf. Eine Kirche, die ihren Schatz unter die Leute bringt, wird staunend entdecken, wie reich sie in Wahrheit ist.