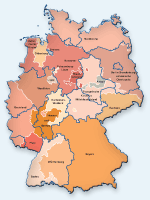Grußworte
6. Tagung der 10. Synode der EKD, Dresden, 04. - 07. November 2007
Grußwort des Bundesministers Dr. Thomas de Maiziére
04. November 2007
Es gilt das gesprochene Wort.
-unredigierte Fassung-
Sehr geehrte Frau Präses, liebe Frau Rinke,
sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, lieber Bischof Huber,
sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder,
meine sehr verehrten Damen und Herren!
Sie werden sich vorstellen können, dass ich mich besonders darüber gefreut habe, dass Sie entschieden haben, die Synode in Dresden zu machen. Dabei kann ich viele Interessen miteinander verbinden. Über Dresden wird sicher noch der Vertreter der Stadt sprechen. Ich möchte Ihnen heute die herzlichen Grüße der Bundeskanzlerin und der gesamten Bundesregierung überbringen.
Nun könnte ich viel über die erfolgreiche Arbeit der Bundesregierung sagen; das werden Sie sicher eigentlich auch erwarten. Sie würden dann sagen: Ja, ja, das stimmt schon; aber das eine oder andere fehlt. Ich schlage Ihnen vor, dass ich diese Art Rede ungehalten zu Protokoll gebe. Ich will es mir und Ihnen heute ein bisschen schwieriger machen und als Kirchenmitglied und als Mitglied der Bundesregierung einige Anmerkungen über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Staat und Kirche aus der Sicht eines befreundeten staatliches Gegenübers machen.
Aus beiden Perspektiven sehe ich zunächst Parallelen zwischen Staat und Kirche in unserem Land. Staat und Kirche stehen in unserem Land vor ähnlichen Herausforderungen. Beide stehen vor der Notwendigkeit von Veränderungen, und beide debattieren intensiv und dabei vorzugsweise nach innen gerichtet - Bischof Bohl hat darüber schon gesprochen - über zu hohes oder zu niedriges Reformtempo. Im staatlichen Bereich ist das Wort „Reform“ inzwischen ziemlich abgenutzt, und viele Menschen verbinden mit ihm leider vorwiegend Negatives. Ist das in der Kirche so viel anders?
Staat und Kirche stehen beide vor der Aufgabe, dass die Menschen mitgenommen werden und die notwendigen Veränderungen akzeptieren müssen. Die Kirchenmitglieder müssen ebenso wie die Staatsbürger überzeugt werden, dass wir sie nicht nur auf den richtigen Weg führen, sondern dass sie selbst gewissermaßen die Führung übernehmen müssen. Nicht nur das Schiff, das sich „Gemeinde“ nennt, sondern auch das Staatsschiff wird seinen Weg in den sicheren Hafen und wieder auf hohe See nur finden, wenn die Menschen auf dem Schiff aus eigener Überzeugung mithelfen.
Von welchen Herausforderungen spreche ich? Ich will nur zwei Beispiele nennen; Sie kennen sie alle. Sowohl die Globalisierung als auch die demografische Entwicklung stellt uns vor neue Aufgaben, die nicht ohne weiteres mit den bisherigen Methoden zu lösen sind. Das gilt sowohl für den Staat als auch für die Kirchen, wenn sie auch für künftige Generationen verantwortlich handeln wollen.
Zunächst zur Globalisierung. In einer Welt, in der alle Länder in einem immer stärkeren wirtschaftlichen Wettbewerb stehen, nimmt die wechselseitige Abhängigkeit zu. Es gibt eine Konkurrenz mit Menschen z.B. in Indien oder China, die ebenso gut qualifiziert sind und wesentlich weniger Lohn bekommen. Wenn Millionen Menschen in China nur etwas mehr Milch trinken, steigt bei uns der Preis, und wir debattieren über den Anpassungsmechanismus von Hartz 4. Wenn auf der einen Seite des Rheins Kernkraftwerke gebaut und auf der anderen Seite abgeschaltet werden, ändert sich zwar etwas an den Kosten der Energie in Deutschland, nicht aber an der Sicherheit der Menschen, die dort leben. Viele Menschen werden dadurch verunsichert. Das ist verständlich. Es ist eine Aufgabe der Politik, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und Maßnahmen zu ergreifen, wo es notwendig ist.
Die christlichen Kirchen stehen vor ähnlichen Aufgaben. Der Kirchgang ist für viele Menschen - auch für viele Kirchenmitglieder - seit langem nicht mehr selbstverständlich. Neue religiöse Angebote haben sich in Deutschland fest etabliert. Auf der einen Seite erleben wir heute Glaubensvergessenheit und auf der anderen Seite eine merkwürdige Art von Frömmigkeit und Glaubensversessenheit. Aber die Suche nach Sinn und Orientierung in einer Welt, die sich immer schneller verändert, ist unübersehbar. Die christlichen Kirchen haben dafür das passende Angebot, wenn ich das einmal so ausdrücken darf. Die Politik tut sich da schwerer.
Vergleichbare Herausforderungen für Politik und Staat ergeben sich auch aus dem gesellschaftlichen Wandel, aus der Tatsache, dass die Menschen älter werden. Das Älter-Werden ist übrigens sehr erfreulich und keineswegs eine Bedrohung. Von Bischof Bohl habe ich gelernt, dass wir eigentlich nicht von einer Überalterung, sondern von einer Unterjüngung sprechen sollten; das Problem ist nicht, dass wir viele alte Menschen haben, sondern dass wir zu wenig Kinder haben.
Die Bundesregierung steht vor der Aufgabe, die soziale Sicherheit der Menschen auch unter der gegenwärtigen und der künftigen Bedingung sicherzustellen, dass in Deutschland immer mehr ältere Menschen leben und dafür immer weniger Menschen für Renten und Pensionen aufkommen. Dieses Thema ist Ihnen gut vertraut; denn Sie haben sich aus den gleichen Gründen mit sinkenden Mitgliederzahlen und rückläufigen Einnahmen der Kirchengemeinden zu beschäftigen. Die EKD hat deshalb einen sicher nicht ganz einfachen Reformprozess begonnen, der das ehrgeizige Ziel hat, gegen den bisherigen Trend zu wachsen, die Mitgliederzahl also zu erhöhen. Die EKD steckt nicht den Kopf in den Sand, sondern sie will die gesellschaftlichen Veränderungen nutzen, um sich auf die Grundlagen des kirchlichen Handelns zu konzentrieren und dadurch neue Mitglieder zu gewinnen. Deswegen haben Sie sich auch für diese Synode das Schwerpunktthema „evangelisch Kirche sein“ gewählt. Das ist gut, das ist ein großes Thema.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie zu neuen Antworten kommen und die in Wittenberg begonnene Zukunftsdebatte fortsetzen. Aber Sie müssen gewissermaßen nur unter den in Deutschland vorhandenen Menschen mehr für sich gewinnen. In der Politik stehen wir vor der Aufgabe, dass wir insgesamt mehr werden müssen und dass wir insgesamt mehr Kinder brauchen.
Ich finde es ermutigend, dass die EKD sagt: Reduzieren und kleiner werden ist für uns keine zufrieden stellende Perspektive. Sie sagen, evangelische Kirche soll langfristig wieder größer werden, nicht nur in der Zahl ihrer Mitglieder - denn das ist sicher ein sehr langer Weg -, sondern auch in den Inhalten und klarer im Bekenntnis.
Das alles ist eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance. Auf dem Markt der religiösen Möglichkeiten muss eine Kirche, die sich selbst - ich weiß nicht, ob ich vor der Synode der EKD das Wort „Kirchentag“ in den Mund nehmen darf - als lebendig, kräftig und schärfer versteht, eine solche Kirche muss keine Angst um ihre Zukunft haben. Verzagtheit ist nicht und darf nicht eine Visitenkarte der Christen sein.
Der deutsche Protestantismus kann auch heute noch immer auf eine große Substanz bauen, gerade übrigens auch in Sachsen. Ich habe mich gefreut zu lesen, dass immer noch mehr Menschen am Sonntagmorgen in die Kirche gehen als am Samstagnachmittag in die Fußballstadien. Das muss gelegentlich mal gesagt werden. Es gibt auch manche, die zu beiden Veranstaltungen gehen. Meine Damen und Herren, so viel zu den Gemeinsamkeiten oder gemeinsamen Herausforderungen.
Nun aber zu einigen Unterschieden. Die richtige Zuordnung der Aufgaben von Staat und Kirchen ist in Deutschland eine Frage mit reicher historischer Tradition, die nicht erst mit dem Augsburger Religionsfrieden des Jahres 1555 begonnen hat. Heute enthält unser Grundgesetz klare staatskirchenrechtliche Regelungen, die sich bewährt haben. Die rechtliche Ähnlichkeit vom Körperschaftsstatus bis zum Beamtenrecht darf aber nicht dazu führen, dass Kirche sich dem Staat gleichmacht - oder umgekehrt.
Wie sollen Kirche und Staat also täglich miteinander umgehen? Kirche soll sich einmischen, auch in Politik, aber wie? Dietrich Bonhoeffer hat intensiv über die Möglichkeiten des Wortes der Kirche an die Welt nachgedacht. Er stellt fest, dass die Kirche nicht auf alle sozialen oder politischen Fragen eine Antwort haben kann oder haben muss. Außerdem sagt er, dass das Evangelium nicht seinen Sinn darin habe, weltliche Probleme zu lösen, und dass darin auch nicht die wesentliche Aufgabe der Kirche bestehen könne. Dieses, so Bonhoeffer weiter, bedeute aber natürlich nicht, dass die Kirche in dieser Hinsicht, nämlich in politischen Dingen, überhaupt keine Aufgabe hätte. Wesentlich sei jedoch, dass die Aussage der Kirche sich aus dem Christentum und nicht etwa aus weltlichen oder politischen Regeln herleite. Ich finde das sehr überzeugend. Sogar in der Situation des Zweiten Weltkrieges, in der die Versuchung groß war, die Kirche ungeduldig zu einem sofortigen Eingreifen aufzufordern, kam Bonhoeffer zu einem so abgewogenen Urteil.
Die Frage, wie kirchliche Worte zu politischen Fragen gestaltet sein können, ist hochaktuell. In einem der vorbereitenden Texte für diese Synode habe ich gelesen, dass die evangelische Kirche „ihre Glaubensbotschaft weder situationsvergessen noch herkunftsvergessen einbringen würde. Sie soll eine biblisch profilierte Zeitgenossenschaft jenseits von Säkularisierung und Fundamentalismus anstreben.“ Diese Worte erinnern mich stark an die Überlegungen von Dietrich Bonhoeffer, die ich zitiert habe.
In der Forderung nach einer biblisch profilierten Zeitgenossenschaft steckt aber natürlich auch die Frage, wie diese Forderung konkret umgesetzt werden soll. Wenn schon die Sprache kirchlicher Kundgebungen - ich nehme einmal diesen schönen alten Begriff aus der Kirchenverfassung - so ist wie die vom ADAC, dem Roten Kreuz oder dem DGB, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Kirche in der sozialen und politischen Debatte dann auch genau so wahrgenommen wird.
Es gibt so unendlich viel politische Geschwätzigkeit. Bitte reihen Sie die evangelische Kirche da nicht ein. Die Aufgabe der Kirche ist nicht primär, sich in das Stimmengewirr von Institutionen und Verbänden einzureihen, sondern den Menschen Impulse für ein Leben aus dem Christentum zu geben und dadurch einen Beitrag zu einer besseren Welt zu liefern. Die Botschaft soll zum lebendigen Zeugnis anregen. Wo dies erfolgt, wird aus dem Christen ein Homo politicus im besten Sinne des Wortes, wird Kirche auch in der Gesellschaft zum Motor für Veränderungen. In diesem Sinne würde ich mir mehr biblisch profilierte Zeitzeugen denn Zeitgenossen wünschen, mehr Akteure denn Kommentatoren.
Das Verhältnis von Staat und Kirche ist nach Jahrhunderten einer wechselvollen deutschen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg im ruhigen Fahrwasser angekommen. Es ist aber immer wieder aufs Neue unter dem Blick eines kritischen Dialogs zu definieren, und zwar kirchlicherseits wie auch staatlicherseits. Denn auch der religiös und weltanschaulich neutrale Staat ist auf Voraussetzungen angewiesen, die er selbst nicht garantieren kann, wie sie das alle aus dem berühmten Wort von Böckenförde kennen. Aber auch die Kirche in Deutschland ist umgekehrt wohl auch, um es einmal provokativ auszusprechen, auf diesen Staat angewiesen.
Die Frage der richtigen Zuordnung von politischer und religiöser Rede halte ich dabei für ganz zentral. Nicht nur für die kirchliche Verkündigung, sondern auch in der Politik lohnt es sich gelegentlich, die eigene Sprache kritisch zu prüfen.
Dabei geht es nur scheinbar um Rhetorik. In Wirklichkeit geht es mehr um die Inhalte, die politische Sprache benennen soll. Denken Sie nur an das Wort „Betroffenheit“. Das ist ein Wort, das wir im kirchlichen Raum durchaus verwenden, warum auch nicht? Kirche ist ein angemessener Ort für Betroffenheit, wenn sie von Herzen geäußert wird.
Im politischen Raum dagegen ist Betroffenheit, vielleicht auch durch zu häufigen Gebrauch in den letzten Jahren, eher zu einer fragwürdigen, beinahe schon abgenutzten Vokabel geworden. Von Politikern erwarten die Menschen zwar zu Recht die Fähigkeit zu ehrlichem Mitgefühl, aber Betroffenheit steht, obwohl sie auch in der Politik gelegentlich durchaus angebracht sein kann, heute manchmal fast schon gleichwertig für Hilflosigkeit. Hilflosigkeit aber erwartet man von einem Politiker, der sich im Idealfall nicht durch Worte, sondern durch Taten auszeichnen soll, in der Regel nicht. Wir brauchen mehr Substanz und weniger Betroffenheit.
Die Botschaft der Kirche darf nicht Betroffenheit, Veränderungsangst oder als Toleranz deklarierte Selbstzweifel sein, die Botschaft der Kirche ist Zuversicht aus dem Glauben. Das hebt die Kirche vom Staat und allen sonstigen Verbänden heraus und macht ihren unverwechselbaren originären Wert aus. Weil die Botschaft eine andere ist, bedarf es einer anderen, eigenen Sprache, selbst wenn der Adressat derselbe ist wie derjenige im politischen Diskurs.
Schließlich gibt es noch einen Unterschied zwischen Kirche, jedenfalls im Alltag, und Staat, jedenfalls soweit er gemeinwohlorientiert ist. Kirche darf selektiv sein: Sonntags wird ein Predigttext behandelt, nicht die ganze Bibel. Das Engagement für die Pflegebedürftigen ist nur ein Teil des Themas Pflege. Friedensarbeit ist nur ein Teil von Sicherheitspolitik. Was aber, wenn das, was Sie „Vorbereitung für den Frieden“ nennen, scheitert?
Der Staat muss das Ganze betrachten. Da wirkt die öffentliche Arbeitsteilung manchmal so, dass die einen für das Gute stehen und die anderen den Einzelnen um des vermeintlichen Gemeinwohls willen außer Acht lassen. Ich wünschte mir, dass die Kirche bei politischen Kundgebungen - ich nehme den Ausdruck nochmals auf - mehr auf das Ganze schaut und umgekehrt die Politik vor lauter Strukturfragen, Sachzwängen und legitimen Machtfragen nicht den einzelnen Menschen aus dem Blick verliert.
Liebe Schwestern und Brüder, seit fast sechs Jahrzehnten gibt es die vom Grundgesetz garantierte Partnerschaft von Staat und Kirche in Deutschland. Die Kirchen haben den Aufbau eines Staates in Deutschland entscheidend geprägt. Ihre Einmischung in Politik, auch in Tagespolitik, hat zum Gelingen dieses Staates beigetragen. Wo könnte man das glaubwürdiger sagen als hier? Christen in der DDR haben maßgeblich dazu beigetragen, dass wir heute gemeinsam in Dresden überhaupt eine Synode der EKD besuchen können.
Das weist auf eine weitere eminent wichtige Gemeinsamkeit von Kirche und Staat hin. Beide sind ohne das glaubwürdige Zeugnis von Menschen undenkbar. Nur wo Menschen sich engagieren, entsteht lebendige Gemeinde, und nur wo Menschen sich engagieren, hat Demokratie ein festes Fundament.
Das lehrt uns die friedliche Revolution von 1989, das fordert uns heute mehr denn je heraus. Was Sie, aber auch wir Politiker, niemals aus dem Blick verlieren dürfen, ist dies: Christen wissen, dass den irdischen Mächten Grenzen gesetzt sind und Grenzen gesetzt werden müssen. Trotz noch so großer Anstrengungen an Kirche, Gesellschaft oder Politik wird es aus menschlicher Kraft nicht gelingen, vollkommenes Heil und umfassende Gerechtigkeit für die Menschen in der Welt zu erreichen. Im Erfolg demütig, in der Niederlage nicht verzweifelt zu bleiben - das ist ein großer christlicher Schatz im Leben, auch und gerade im Leben von Politikern.
Ihnen allen, die Sie sich zur diesjährigen Tagung der 10. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland versammelt haben, wünsche ich nun, mit Gottes Segen, erfolgreiche und zukunftsweisende Beratungen.