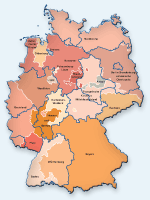Texte zum Schwerpunktthema
“Tolerant aus Glauben“
Referat zur Einführung in das Schwerpunktthema
Dr. Elisabeth von Thadden
4. Tagung der 10. Synode der EKD, Berlin, 6. - 10. November 2005
Es gilt das gesprochene Wort.
„Glaubensfestigkeit und Toleranz – Christsein in einer Situation religiöser, weltanschaulicher und kultureller Vielfalt“
Meine Damen und Herren! Sehr geehrte Synodale! Ich bin es, die sich freut, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen, und dies obwohl – vielleicht auch weil – Sie mir kaum ein vertrackteres Thema hätten antragen können. Glaubensfestigkeit und Toleranz, Christsein in einer Situation religiöser Weltanschaulichkeit und kultureller Vielfalt: Je länger ich mich mit diesem Thema befasst habe, desto unfreundlicher sind mir sämtliche Gefahren meines eigenen Berufs - ich bin Journalistin - begegnet, die da heißen: Gattung verfehlt, Thema verfehlt, Leser nicht erreicht, erste Fassung zerrissen, zweite Fassung zerrissen, dritte Fassung zerrissen. Nun, irgendwann ist zum Glück immer Redaktionsschluss.
Also liefere ich Ihnen nun ab, was sich aus meiner Perspektive nach der Arbeit der vergangenen Monate sagen lässt. Ich hoffe, im Folgenden Ihre Toleranz nicht zu sehr zu strapazieren – strapazieren möchte ich Sie aber doch ein wenig.
Die Glaubensfestigkeit hat es nicht leicht in der weltanschaulichen Vielfalt, und die Toleranz gehört nicht zu den Künsten, in denen das Christentum sich schon immer hervorgetan hat. Historisch trägt es bekanntlich eine lange Geschichte der Intoleranz mit sich. Selbst ein Erasmus von Rotterdam liegt trotz seines legendären Humanismus darin befangen, die Juden als – ich zitiere – „gottvergessenes und gotteslästerndes Volk“ der christlichen Duldung anheim zu stellen, vor dem eschatologischen Horizont, dass die Bekehrung der Juden am Ende der Zeiten schon erfolgen werde. Gedanken zur Toleranz haben es unvermeidlich mit einer Geschichte mörderischer Intoleranz zu tun, und doch müssen sie weiterkommen. Wir stehen also vor Schwierigkeiten.
Der französische Philosoph Pierre Bayle – Jürgen Habermas’ letztes Buch „Naturalismus und Religion“ hat mich wieder auf ihn hingewiesen – legte zu Beginn der Aufklärungsepoche als Erster den Finger in die Wunde, dass die Nagelprobe der Toleranz nicht im Ertragen des anderen, sondern in der Wechselseitigkeit der Anerkennung bestehe. Er schreibt vor gut 300 Jahren – und Anklänge an die Gegenwart wären rein zufällig –: „Wenn darum den Mufti die Lust überkommen sollte, zu den Christen einige Missionare zu entsenden, wie der Papst solche nach Indien schickt, und man diese türkischen Missionare dann dabei überrascht, wie sie in unsere Häuser eindringen, um ihre Aufgabe als Bekehrer zu erfüllen, so glaube ich nicht, dass man befugt wäre, sie zu bestrafen. Denn wenn sie die gleichen Antworten gäben wie die christlichen Missionare in Japan, nämlich dass sie aus Eifer gekommen seien, die wahre Religion denen, die sie noch nicht kannten, bekannt zu machen und für das Heil ihrer Nächsten zu sorgen, wenn man dann diese Türken aufknüpfte, wäre es nicht eigentlich lächerlich, es schlecht zu finden, wenn die Japaner ebenso handelten?
Sich in die Perspektive des anderen zu versetzen, seine Überzeugung als eine gleichrangige zu verstehen, ist erst eine moderne Errungenschaft der Aufklärung. Gleichwohl setzt sich die Geschichte christlicher Missionierung in der Kolonialgeschichte des 19. Jahrhunderts außerhalb Europas fort, sodass der Export der westlichen Moderne in vielen Weltteilen bis heute schmerzliche Spuren hinterlässt, die das moderne Gebot wechselseitiger Toleranz als fragwürdig erscheinen lassen und oft heftigen Einspruch gegen unsere Moderne hervorrufen. Bis heute ist die Toleranz aber zu einer der Grundfragen an die Werte moderner heterogener und pluralistischer Gesellschaften geworden. Wie Individuen, Gesellschaften, Institutionen, wie die Kirche und ganze Gemeinwesen mit ihr umgehen, steckt voller Konflikte und Unschärfen. Und die Flucht in ein banales Verständnis von Toleranz um des lieben Friedens willen liegt daher nahe. Nur rückt so der Frieden erkennbar nicht näher.
Paul Ricoeur, der Philosoph und Hermeneutiker, der Kenner der menschlichen Seele und ihrer Zeichen, der Christ und französische Protestant, er hat ja recht: „Die Rede von der Toleranz“, sagt der alte Herr lakonisch, „setzt sich einer doppelten Gefahr aus: banal zu sein oder zu einer Verwechslung zu führen.“ Die Gefahr der Banalität steckt in der achselzuckenden Gleichgültigkeit. Mache doch jeder, was er für richtig hält. Die andere Gefahr aber liegt in der Verwechslung von Sphären, in denen durchaus unterschiedliche Bedeutungen des Begriffs Toleranz walten, in Konkurrenz treten und in sich ambivalent sind: Der politischen Sphäre der Staatsbürgerlichkeit und des Gemeinwesens, der kulturellen Sphäre der Gesellschaften und schließlich - oder vielleicht erstens - der theologisch-religiösen Sphäre subjektiver Überzeugungen.
Eben dies ist die Malaise, die uns nun für die Dauer meines Vortrages begleiten soll und aus der ich dennoch uns ein wenig frei zu rudern hoffe.
Ich möchte mich aus dieser Schwierigkeit in drei Schritten befreien. In einem ersten Schritt möchte ich mich der Beschreibung einer Gesellschaft zuwenden, in der bis weit ins Diffuse hinein religiöser und weltanschaulicher Pluralismus herrscht und vieles geschieht, was wir nicht hinnehmen können. In einem zweiten Schritt möchte ich das philosophische und christliche Verständnis von Toleranz historisch ein wenig zu klären versuchen. Und in einem dritten Schritt schließlich will ich eine Annäherung an die Frage versuchen, was dies für die Haltung von Christen heute bedeuten kann, vielleicht sogar besonders der protestantischen Christen, und darüber hinaus für die Kirche.
Sie werden vielleicht merken, dass Paul Ricoeur, der im letzten Jahr gestorben ist, ein treuer Begleiter in diesem Vortrag ist, und das ist kein Zufall.
Um Paul Ricoeurs Gefahr der Banalität zu umschiffen, möchte ich Sie hier nicht mit Toleranzfragen aufhalten, die der Rechtsstaat nach einiger Abwägung ja nachweislich gut selbst klären kann. Die Debatten um das Kruzifixurteil und das Kopftuchverbot haben uns allerdings gelehrt, dass es bei der Diskussion, was wir unter Toleranz verstehen wollen, um mehr geht als um die Duldung von Unterschieden. Vielmehr stellen sie uns vor die Frage, ob eine demokratisch verfasste Gesellschaft den Schritt machen will, Unterschiede als Abweichungen von der Norm nicht nur zu erlauben, sondern darüber hinaus den Respekt aufzubringen, die Haltungen von Minderheiten als ebenso legitim zu respektieren wie diejenigen von Mehrheitskulturen. Auf diesen Unterschied muss ich noch zurückkommen.
Ich will auch nicht auf das ganze Spektrum weltanschaulicher Vielfalt eingehen, das jedem von uns alltäglich begegnet: der esoterischen Neoreligiosität etwa, der religionsähnlichen Verehrung des Marktes, der religionsähnlichen Begeisterung für den Massensport, auch nicht der religionsähnlichen Wissenschaftsgläubigkeit allesamt Herausforderungen an ein glaubensfestes Christentum und möglicherweise doch nicht wirklich die Konfrontation mit dem Nichttolerierbaren.
Stattdessen begebe ich mich auf ein Feld, in dem die Toleranz in besonderer Weise der Klärung bedarf. Ich möchte das Portrait der Gesellschaften, in denen wir leben und tolerant sein wollen, am Beispiel der niederländischen Muslima Aysaan Hirsi Ali zeichnen, das heißt, von der Herausforderung des Nichttolerierbaren aus vorzugehen. Das heißt aber auch, der kulturellen Ausprägung von Toleranz und Intoleranz zu begegnen und sich von ihr irritieren zu lassen.
Diese Frau Aysaan Hirsi Ali ist ein Flüchtling aus Somalia, die ihren Kampf für einen aufgeklärten Islam und gegen die Rückständigkeit ihrer Religion gegenüber Frauen in den liberalen Niederlanden so rückhaltlos führt, dass sie längst von Leibwächtern vor den Todesdrohungen der Radikalen geschützt werden muss – von staatliche bestellten Beamten des Landeskriminalamtes.
Unter anderem beklagt diese Muslima öffentlich die liberale Toleranz der niederländischen Öffentlichkeit, und zwar gegenüber dem konservativen Islam, der die Religion, wie sie sagt, als „Eichmaß der Moral, als Richtschnur für das Leben“ versteht und also jeden Kritiker als Sünder bekämpft. Die liberalen Dulder aber, die im Namen der Toleranz den Respekt vor dem Andersdenkenden in Ehren halten und damit Grausamkeiten gegenüber muslimischen Frauen hinnähmen, waren der Grund, aus dem sich Aysaan Hirsi Ali politisch von einer Linksliberalen zur Vertreterin der rechtsliberalen, man kann auch sagen rechtspopulistischen „Volkspartei für Freiheit und Demokratie“ wandelte. Sie hatte genug von der Toleranz – und sie profitiert doch von der Meinungsfreiheit, die der niederländische Staat mit ihrer Person aufwändig schützt.
In dieser Geschichte sind alle Sphären im Spiel, die miteinander zu verwechseln Paul Ricoeur als Gefahr bezeichnet hat: die politische, die kulturelle und die religiös-theologische. Sie verwirren sich umso mehr, je klarer man wahrnimmt, dass die Positionen der Beteiligten ihrerseits allesamt kulturell relativ sind. Ganz offenkundig hält die niederländische Öffentlichkeit die Anerkennung freier Religionsausübung für geboten. Ganz offenkundig meinen die Feinde jener Muslima aber, deren Haltung nicht tolerieren zu müssen. Ganz offenkundig zielt Aysaan Hirsi Alis Kritik der Religion nicht gleichermaßen auf ihre eigene wie auf die aufgeklärte ihres Zufluchtslandes. Und ebenso offenkundig bewegt sich die für Westeuropäer unerträgliche Situation vieler muslimischer Frauen in einer Grauzone zwischen Rechtswidrigkeit und selbstverständlich zu tolerierender kultureller Differenz – die Freiheit der kulturell verschiedenen Religionsausübung ist eben so grundgesetzlich geschützt wie die Religionsfreiheit selbst und muss aber im Zweifelsfalle mit den Geboten freier Selbstbestimmung und körperlicher Unversehrtheit abgewogen werden, hinter der selbstverständlich in unserem Rechtsstaat die Religionsausübung zurücksteht.
Doch nicht minder wichtig ist es, in diesem Zusammenhang auf die ausgeblendeten, also keineswegs offenkundigen Faktoren des Konflikts hinzuweisen. Die Ängste, die fundamentalistische Gewalt von Muslimen ausgelöst haben, verleiten dazu, die regionale, soziale und kulturelle Vielfalt des Islam zu übersehen und den Islam insgesamt als rückständig zu skandalisieren. Dabei weisen verschiedene muslimische Organisationen die Beschneidung von Frauen als ein Relikt vorislamischer Zeiten zurück, das im Islam nicht erlaubt sei. Tatsächlich ist diese Praxis nur in verschiedenen afrikanischen Staaten üblich. In der Türkei gilt sie genauso wie in Deutschland als schwere Körperverletzung. Auch innerhalb des Islams gilt also die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigkeiten, sind die Befürwortung der Moderne und deren Ablehnung sozial und regional verschieden ausgeprägt. Dem Islam rundum eine atavistische Frauenfeindlichkeit zuzuschreiben, geht nicht selten damit einher zu vergessen, dass etwa im katholischen Italien noch vor wenigen Jahrzehnten Zwangsehen und Ehrenmorde geläufig waren. Das Kopftuch muslimischer Frauen zu skandalisieren, geht oft damit einher zu übersehen, dass noch vor kurzem eine christliche Bäuerin, etwa in den ländlichen Gebieten der Alpen, selbstverständlich ihr Haar unter dem Kopftuch zu tragen hatte. Ich weiß wohl um den Unterschied zwischen dem öffentlichen Dienst und dem Tragen des Kopftuches in der Kirche. Oft hat es die Toleranz mit Phänomenen zu tun – das möchte ich sagen –, die in der eigenen Kultur als kaum überwunden gelten und umso ängstlicher in anderen Kulturen wahrgenommen werden. Auch wir haben mit den Problemen der Enttraditionalisierung unserer Gesellschaften zu tun. Wo immer Gesellschaften sich enttraditionalisieren, verlieren sie viel und also ist Angst im Spiel. Unsere Errungenschaften des modernen Rechtsstaats sind nicht einfach nur Errungenschaften, sondern sie bedeuten auch, Traditionen verloren zu haben, auf die sich andere Kulturen, bisweilen zu unserem Missfallen, beziehen. Oft also hat es die Toleranz mit Phänomenen zu tun, die in der eigenen Kultur als kaum überwunden gelten und umso ängstlicher in anderen Kulturen wahrgenommen werden. Dies gilt übrigens nicht zuletzt für die Wahrnehmung des islamischen Antisemitismus der Gegenwart.
Wir kommen aus dieser Verwirrung nur heraus, wenn wir den Begriff der Toleranz konstitutiv als einen Begriff verstehen, der historisch und kulturell relativ ist, und für den europäischen Rahmen zwischen der staatsbürgerlichen Dimension und der individuellen der Überzeugung unterscheiden – was viele Kritiker der westlichen Moderne nicht billigen. Das ist ein Teil unserer Schwierigkeiten. Beides will ich aber nun hier versuchen.
Der Philosoph Rainer Forst hat argumentiert, dass es gegenwärtig, im Dickicht diffuser Toleranz-Vorstellungen, nur ein sinnvolles Toleranz-Konzept gebe. Dem möchte ich mich anschließen. Es umfasst drei Merkmale:
Erstens lässt sich von Toleranz nur dann sinnvoll reden, wenn man davon ausgeht, dass eine Überzeugung als falsch abgelehnt wird. Wäre dem nicht so, würde die andere Überzeugung bejaht oder gleichgültig hingekommen, nicht aber toleriert. Die Überzeugung des anderen ist also falsch. Zweitens lässt sich von Toleranz nur dann sinnvoll reden, wenn zur Ablehnung die begründete Akzeptanz hinzukommt, wenn also Gründe bestehen, das für falsch Gehaltene dennoch zu tolerieren. Drittens lässt sich von Toleranz nur dann sinnvoll reden, wenn deren Grenzen benannt werden, wenn also klar ist, dass das Intolerierbare zurückgewiesen und also geahndet wird.
Rainer Forst verdanken wir darüber hinaus die historisch qualifizierte Unterscheidung zwischen einem genuin vormodernen Toleranzbegriff und dem modernen.
Der vormoderne, gegen den sich die Aufklärung wendet, betont den Aspekt der Duldung des Andersdenkenden und gewährt ihm Schutz unter der Bedingung, dass er sich dafür als gehorsamer Untertan zu erweisen habe. Ihm wohnt ein Moment von Herrschaft inne. Der moderne Toleranzbegriff hingegen, auf den sich der eingangs zitierte Pierre Bayle zu bewegt, betont demgegenüber den Respekt unter strukturell Gleichen, die wechselseitige Anerkennung von Gesellschaftsmitgliedern und ihrer Rechte. Ihr trägt ein modernes Gemeinwesen dadurch Rechnung, dass seine Normen von allen gleichermaßen akzeptiert werden können. Aus dieser modernen Toleranzkonzeption folgt, dass ein Gemeinwesen weltanschaulich neutral zu sein hat, wovon die Rede noch sein muss.
Unkompliziert wird die Lage durch diese Unterscheidung aber leider nicht. Denn beide Aspekte, sowohl die Duldung als auch der Respekt, stehen in modernen westlichen Demokratien wie der unseren in stetem Konflikt miteinander.
Lassen Sie mich zunächst in aller Kürze ein paar Stationen der christlichen Toleranz-Geschichte in Erinnerung rufen. Ursprünglich hat die tolerantia, die Duldsamkeit, in der frühchristlichen Geschichte mit der Leidensbereitschaft des Einzelnen gegenüber anderen Menschen zu tun und zielt in Bezug auf die Haltung der Kirchen auf die Duldsamkeit gegenüber Ketzern, Heiden und Juden. In der grundlegenden Auffassung des Kirchenvaters Augustinus etwa ist tolerantia eine Konsequenz aus der Sündhaftigkeit und Endlichkeit des Menschen, der darauf verwiesen ist, vom Mitchristen in Liebe ertragen zu werden. Die tolerantia Gottes – dies ist der genuin christliche Toleranz-Gedanke – gilt umfassend jeder menschlichen Kreatur, wie auch immer gottverlassen sie leben mag.
Mit Thomas von Aquin tritt das naturrechtliche Argument zum Duldungsgebot hinzu: Der Heilsauftrag dürfe nicht wider die Freiheit durchgesetzt werden. Nicolaus von Cues fügt der Geschichte der Toleranz die entscheidende Weiterung hinzu, dass nämlich die eine Religion sich in vielgestaltigen Ausdrucksweisen darstelle. Alle Religionen als Teilwahrheiten sind Erläuterungen der einen göttlichen Wahrheit. Für die Bestimmung der Grenzen der Toleranz hat schließlich Erasmus von Rotterdam die weltliche Macht in Betracht gezogen: Es komme nur den weltlichen Fürsten zu, Häretiker zu bestrafen, und zwar ad tuendam Rempublicam, zum Schutz des Gemeinwesens.
Eine Vergegenwärtigung der Toleranz-Geschichte – das ist vor diesem Publikum unausweichlich – ist natürlich darauf angewiesen, den Beitrag Martin Luther besonders hervorzuheben – trotz der unbestreitbar intoleranten Handlungen von Reformatoren gegenüber Juden, Papisten, Dissidenten. Mit Luther, der das Wort „Toleranz“ ins Deutsche brachte, ist die Formulierung des Konflikts zwischen dem individuellen Gewissen und den Dogmen der Kirche, der Verfügungsgewalt des Staates in der Welt. Die Bindung allein an das Wort Gottes und den persönlichen Glauben sollte seither für Protestanten die Grenze jeden Gehorsams bedeuten. – Realgeschichtlich allerdings lässt die Geschichte des protestantischen Untertans diese Freiheit immer wieder vermissen.
Religionspolitisch virulent wird die Gewissensbindung im Folgenden als Toleranz-Gebot, das im modernen Staat waltet. Aus dem christlichen Ertragen von Differenzen wird erst zu Beginn der Neuzeit langsam das aktive Eintreten für die Freiheit und Rechte des anderen, dessen Überzeugungen ich nicht teile. Erst nach der Reformation gewinnt der Begriff in der Diskussion um die Normen des Gemeinwesens seine modernen Bedeutungen. Auffälligerweise taucht er weder im Augsburger Religionsfrieden noch im Edikt von Nantes auf – auch viel später nicht in der Verfassung der Bundesrepublik. Toleranz ist als Norm anwesend; ausdrücklich festgeschrieben ist sie nicht.
Tritt man nun der Klärung des Begriffs in seinen modernen Bedeutungen näher, so stößt man bald auf jene oft diskutierte Paradoxie der Toleranz, die einen vor die Frage stellt: Wie kann man es für moralisch richtig halten, etwas zu tolerieren, was man für falsch hält? Jeder, der Kinder hat, kennt diese Frage vom Frühstück bis zum Abendbrot.
Nun, historisch gesehen kann man es dann, wenn man vor Erschöpfung nicht mehr anders kann. Das haben heutige Eltern mit der Lage im Dreißigjährigen Krieg vielleicht ein winziges bisschen gemeinsam. Die furchtbare Erschöpfung durch den religiös begründeten Dreißigjährigen Krieg ist die Geburtsstunde der modernen europäischen Toleranz wie des europäischen säkularisierten Staates, der seinen Bürgern, gleich welchen Glaubens, Frieden und Recht sichern will – und es auch muss, um prosperieren zu können. In seinen klassischen Formulierungen heißt diese Begründung des politischen Gemeinwesens zum Schutz der Interessen der Bürger etwa in John Lockes „Letter concerning Toleration“ von 1689, verfasst im holländischen Exil: „All civil power, right and dominion, is bounded and confined to the only care of promoting these things... it neither can nor ought in any manner to be extended to the salvation of souls.“ Das Seelenheil und die zivile Macht müssen sich unabhängig voneinander machen.
Die Kirchen haben in Lockes Augen keinerlei Recht, Zwang gegenüber individuellen Überzeugungen auszuüben, und die staatliche Autorität darf von der Religion nicht in Abrede gestellt werden. Mit der Vorrangigkeit des politischen Gemeinwesens vor den privaten Auffassungen der Bürger steht und fällt dieser neuzeitliche Toleranz-Begriff: um den Preis, wie Rüdiger Bubner heute zurecht feststellt, dass „glaubensgesteuerte Einstellungen“ entpolitisiert worden sind. Fortan soll man glauben können, was man will, solange man sich an die Normen, Regeln und Gesetze des Gemeinwesens hält. Gleichwohl ist Lockes Haltung weder dezidiert antichristlich noch antikirchlich formuliert. Mehr noch: Am Atheismus hat seine Vorstellung von Toleranz ihre Grenze.
Umso zugespitzter aber begründet gleichzeitig und ebenfalls im niederländischen Exil – die religionspolitisch liberalen Niederlande tauchen in diesen Fragen seit Jahrhunderten konstant auf – der französische Philosoph Pierre Bayle, den wir kennen gelernt haben, in seinem „Commentaire sur les paroles de Jésus Christ“, dass niemand zum Glauben gezwungen werden könne, ohne zum Heuchler zu werden. Bayle plädiert wider die Intoleranz der katholischen Kirche für die subjektive Wahrhaftigkeit des Glaubens und die wechselseitige Anerkennung desselben.
Bayles Toleranz-Begriff umfasst nun auch Atheisten und Anhänger anderer Religionen. Die Wechselseitigkeit bleibt bis heute der Prüfstein für Toleranz. Voltaire wird es unübertrefflich in seinem „Traité sur la tolérance“ von 1763 einen weisen Chinesen sagen lassen. Der Chinese sagt als Streitschlichter: „Wenn Sie wollen, dass man Ihre Lehre toleriert, beginnen Sie selbst damit, weder intolerant noch unerträglich zu sein.“ Der Rest erledigt sich dann weitgehend von selbst.
In dieser Schrift finden sich auch jene berühmten Worte, die man heute noch jedem Schulkind auf den Weg geben möchte und die in Lessings „Nathan der Weise“ ihren literarischen Ausdruck finden: „Je vous dis qu’il faut regarder tous les hommes comme nos frères. Quoi! Mon frère le Turc? Mon frère le Chinois? Le Juif? Le Siamois? Oui, sans doute; ne sommes-nous pas tous enfants du meme père, et créatures du meme Dieu?“ „Was, ich soll den Türken, den Chinesen, den Juden und den Siamesen als meinen Bruder akzeptieren ? Ja, zweifellos; denn wir sind alle Kinder desselben Vaters und Geschöpfe desselben Gottes.“
Doch die laizistische philosophische Kultur der französischen Aufklärung wendet sich in diesen Formulierungen trotz der Berufung Voltaires auf den einen Schöpfergott ebenso gegen das Christentum wie gegen die Autorität der Kirche.
Ganz anders und vielleicht in unseren Augen angenehmer klingt da der skeptische Spätaufklärer Goethe in seinen „Maximen und Reflexionen“. Ihm gelingt der Sprung von der formalen Duldung des anderen zu dessen Anerkennung, ohne auch nur auf die Kirche oder den christlichen Glauben oder den Staat Bezug zu nehmen: „Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein; sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen.... Die wahre Liberalität ist Anerkennung.“ Diese Goethesche Argumentation zielt nun auf die Überwindung des Herrschaftsmoments von Toleranz zugunsten jenes Respekts, der den anderen als Gleichen wahrnimmt und also in der politischen Konsequenz verbietet, ihn auszuschließen.
Mit diesen klassischen Formulierungen stecken wir tief in dem Problem der Kulturabhängigkeit des Toleranz-Begriffs, der in Frankreich nur vor dem Hintergrund des Kampfes der Aufklärung gegen die katholische Kirche zu verstehen ist – eine Voraussetzung, die etwa die schwedische Toleranz-Geschichte mit ihrer pietistisch grundierten Begründung des modernen Staates nicht teilt. Der kulturelle Umbruch, den die Entstehung der modernen europäischen Staaten bedeutet, ist eben nicht weltanschaulich neutral und ebenso wenig der moderne Staat selbst.
Der laizistische Rechtsstaat, der sich in Frankreich gegen die Macht der katholischen Kirche entwickelt – dies betont wiederum Paul Ricoeur – hat eben keine Entsprechung in Deutschland, England, den Niederlanden oder Schweden. Gleichwohl sind alle Ausdruck einer Geschichte der Säkularisierung, in der demokratische Rechtsstaaten die Liaison von König und Kirche überwinden, und übrigens nicht nur demokratische Rechtsstaaten. Wer seinerzeit die Erfahrung machen durfte, in den ostdeutschen Kirchen vor 1989 zu leben oder zu Gast zu sein, wird schon durch die relativ engen Grenzen der deutsch-deutschen Verschiedenheiten zu der Überzeugung gelangt sein, dass sich das Christentum und auch Glaubensfestigkeit eben nicht einfach universal, sondern kulturabhängig äußern.
Aber nun stehen wir dem Fall der Muslima Ayaan Hirsi Ali gegenüber und tun uns mit der Goethe’schen Auffassung von Liberalität umgehend schwer, denn das Bedürfnis ist, umgehend die Grenzen der Toleranz und also der Anerkennung zu benennen. In der jüngsten Vergangenheit kommen so verschiedene Denker wie Karl Jaspers und Paul Ricoeur ganz selbstverständlich darin überein, die Grenzen der Toleranz in der absoluten Intoleranz zu sehen, die Gewalt bedeutet, Ausschluss und Eroberung. Der dergestalt Intolerante kann vom Toleranten nicht toleriert werden. Doch wir lebten nicht in pluralistischen Gesellschaften, wäre diese Grenze nicht ihrerseits stets fließend und auf der Grundlage ihrer Verfassung stets neu zu bestimmen.
Die Morddrohungen radikaler Muslime gegenüber Aysaan Hirsi Ali markieren die Grenze für jeden von uns ebenso wie für fast jeden Muslimen eindeutig. Hier ist das Eingreifen des Rechstaates fraglos geboten. Doch schon bei der Beurteilung von Zwangsehen oder in der Bewertung des Kopftuchs, also in Fragen kultureller Symboliken und Traditionen, verlaufen die Grenzen eben anders. An extremen Beispielen der Beschneidung von muslimischen Frauen erkennt man leicht, wie schwer sich der Rechtsstaat damit tun kann, diese Form der Gewalt, die weitgehend im Privaten stattfindet, zu ahnden. Mit der Goethe’schen Empfehlung der Anerkennung allein ist jedenfalls diesen Herausforderungen nicht beizukommen, ohne wiederum kulturspezifisch zu argumentieren.
Jeder weiß, wie unterschiedlich die Konfliktlösungen ausfallen, die etwa in Frankreich, England oder Deutschland gefunden werden, ja selbst innerhalb deutscher Länder. Ob ein muslimischer Arbeitnehmer das Recht hat, für das Gebet die Arbeit zu unterbrechen, ob ein Motorrad fahrender Sikh, der aus religiösen Gründen den Turban trägt, von der Helmpflicht entbunden werden muss, ob eine Ordensschwester im staatlichen Unterricht ihr Ordenshabit ablegen muss, all dies sind Fragen – und der Verfassungsrechtler Dieter Grimm hat sie in wunderbar pluralistischer Komik zusammengetragen –, die im Zweifelsfalle Gerichte in der Abwägung zwischen Respekt und Duldung zu entscheiden haben, und das tun sie auch.
Damit sind wir, dank Ihrer Geduld, endlich weit genug vorangekommen, um der von Ricoeur benannten Gefahr der Verwechslung von politischer, gesellschaftlicher und persönlicher Sphäre der Toleranz entgegentreten zu können. Die persönliche Sphäre der religiösen Überzeugung ist als genuiner Freiheitsgewinn der europäischen Moderne zu verstehen und findet ihren Gegenbegriff in der Gleichgültigkeit. Stets hat sie damit zu tun, sich der Gründe klar zu werden, aus denen die eigene Überzeugung für richtig, die abgelehnte andere für falsch und dennoch für tolerierbar gehalten wird.
Zweitens. Die kulturell-gesellschaftliche Sphäre der Toleranz gebietet den Respekt vor dem Denken des anderen und ist zugleich auf die ständige Überprüfung ihrer Voraussetzungen und Gehalte durch eine Gesellschaft angewiesen.
Die politisch-staatsbürgerliche Sphäre der Toleranz schließlich gründet auf der Priorität des Gemeinwesens vor den Überzeugungen seiner Mitglieder, nicht zuletzt um die Meinungsfreiheit gewähren zu können. Stets hat sie mit dem Konflikt zu tun, der zwischen Duldung und Respekt besteht. Stets hat sie sich mit der Legitimität von Herrschaft zu befassen und also mit der Qualifizierung demokratischer Beteiligung an der Formulierung von Normen. Nur derjenige lässt Gesetze für sich gelten, der hinreichend an ihrer Formulierung beteiligt gewesen ist. Dies hat auch das Ziel, dass ein Gemeinwesen begründet gegen diejenigen Feinde vorgehen kann, die den Grundkonsens der Verfassung bekämpfen. Jürgen Habermas hat zu Recht den zivilen Ungehorsam als Lackmustest dieser politischen Sphäre beschrieben. Alle drei Sphären sind aufeinander angewiesen und aneinander gewachsen, alle drei konstituieren die Gesellschaft, in der wir heute leben.
Wie aber steht es nun um die spezifisch christliche Haltung in diesem Rahmen? Vielleicht denken Sie schon, ich hätte es längst vergessen. Aber ich weiß wohl, dass ich darauf zusteuern soll. Was kann vor diesem Hintergrund „Glaubenfestigkeit“ heißen?
Ich möchte von einer protestantischen Erfolgsgeschichte sprechen. Die protestantische Erfolgsgeschichte ist unter anderem das Grundgesetz. Christen hierzulande haben das ambivalente Glück, dass die Normen und Gesetze unseres modernen Verfassungsstaates in der Gründungsphase der Bundesrepublik nicht wider das Christentum formuliert sind, sondern durchaus auch Ausdruck des christlichen Erbes der europäischen Tradition sind. Sie sind darin, wie Paul Ricoeur festhielt, keineswegs zeitlos neutral, sondern durchaus auch eine Antwort auf die Verbrechen des Nationalsozialismus wider die Menschenwürde. Ein Christ muss sich zu den Normen des Grundgesetzes nicht grundsätzlich im Widerspruch finden oder gar im Widerstand sehen. Er wird vielmehr dafür eintreten, dass Verfassungsanspruch und Verfassungswirklichkeit übereinstimmen. Mit dem Gebot der Unantastbarkeit der Menschenwürde, der Meinungs- und Religionsfreiheit, der Gleichheit aller vor dem Gesetz hat die Überzeugung von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen Ausdruck in der Verfassung gefunden. In der Verpflichtung auf die Gemeinnützigkeit des Eigentums, im sozialstaatlichen Auftrag ist die Überzeugung von der Erbarmungswürdigkeit der Kreatur niedergelegt, die Anerkennung verdient. Die Wahrung der Schöpfung schließlich genießt nicht Verfassungsrang, gleichwohl hat sie sich weit hinein in die Gesellschaft als Norm politisch geltend gemacht. Die Bedürftigkeit und Gebrechlichkeit des Menschen, die einen Kern der biblischen Überlieferung ausmachen, haben ihre Entsprechung in der Gebrechlichkeit und Bedürftigkeit der Natur gefunden, deren Erhaltung – wenn auch nicht explizit – zu den Grundwerten gehört.
Um noch einmal auf den Fall der Ayaan Hirsi Ali zu kommen, kann man sagen: Jeder Christ kann hier allein als Staatsbürger argumentieren – das ist es, was ich als evangelische Erfolgsgeschichte bezeichnen möchte – und bedarf keiner anderen Grundlage für die Verurteilung der Morddrohungen, für die rechtsstaatliche Verfolgung der Täter und für das politische Ringen um die Freiheitsrechte derjenigen Frauen, die ihre Situation nicht bejahen, sondern aus ihrem Leid befreit zu werden wünschen.
Und doch: Ein Christ ist eben nicht nur ein Staatsbürger, der den Grundwerten freiheitlicher Verfassungen anhängt und sie im politischen Diskurs geltend macht. Den Eid auf die Verfassung abzulegen heißt keineswegs die Formel hinzuzufügen: „So wahr mir Gott helfe“. Doch liegt mir viel daran, diese Erfolgsgeschichte als eine Qualität sui generis hervorzuheben.
Ich kann mich der Frage danach, wie es um das christliche Bekenntnis und um die christliche Glaubensfestigkeit in diesem Zusammenhang steht, nur nähern, indem ich von einer inneren Vielfalt des Christentums ausgehe, die schon in den vierfach verschiedenen Evangelien ihren historisch ersten Ausdruck findet. Die Verkündigung von Jesu Leben, Tod und Auferstehung ist in sich so plural wie die ersten christlichen Gemeinschaften. Auch ein noch so inständiger Wunsch, der heutigen vielfältigen Welt durch einen umso gefestigteren Glauben zu begegnen, muss dieser Pluralität ins Auge sehen, darf und muss sich im Lesen, Deuten, Begründen üben und also Gründe für die eigene Haltung angeben, auch wenn Glauben keiner Begründung bedarf.
Diese Zustimmung zum Pluralismus verdankt die Moderne der kritischen Aufklärung, in Ansätzen der Reformation. Wer dies anerkennt, kommt nicht umhin, die je eigene Perspektive zu benennen, die ihrerseits eine Herkunftsgeschichte hat. Das heißt nicht, dem Relativismus das Wort zu reden, sondern vielmehr die genuin protestantische Säkularisierungsgeschichte selbstbewusst anzuerkennen, als Reichtum schätzen zu lernen und in jeder totalisierenden Überzeugung ein Moment von Gewalt und Herrschaft zu bekämpfen
Wie soll man die Pluralität der Bekenntnisse leben und gleichzeitig sich selbst zum Glauben bekennen?“, fragt nun wiederum Paul Ricoeur. Seine Antwort lautet: Indem man eben diese Frage als ein Zentrum der christlichen Botschaft versteht. Sie ließe sich theologisch rechtfertigen, indem man die Nächstenliebe als genuin christlichen Ausdruck der Toleranz begreift und die Geschichte des Christentums also als Weg zum Wesen des christlichen Selbstverständnisses auffasst.
Das möchte ich nun abschließend in einigen Perspektiven versuchen, indem ich das christliche Selbstverständnis von dem politischen und kulturellen dezidiert abhebe.
Ich möchte in wenigen Punkten, die ich nicht ausführlich begründen möchte, von den Gewissheiten sprechen, auf denen Glaubensfestigkeit ruht.
1. Die unaufhebbare Ferne zu der einen Wahrheit lädt dazu ein, den offenen Weg der Verständigung einzuschlagen und die Grenzen der eigenen Auffassungsgabe anzuerkennen. Diese Einladung ist besonders Christen gewiss.
2. Damit geht einher zu erkennen, wie Ricoeur sagt, dass „die ohnmächtige Macht des Wortes“ durch die historische Trennung von politischer Macht und religiöser Überzeugung „in seiner Gewaltlosigkeit“ liegt. Mit Gewalt, durch Gewalt lässt sich die vielfältige Botschaft des Gekreuzigten nicht in die Welt bringen. Das Wort selbst hat verbindliche Autorität, nicht aber die, die es auslegen. Auf diese Autorität können sich Christen verlassen.
3. Die besondere christliche Botschaft, dass Gottes Macht in der Liebe liegt, die sich darin äußert, dass Gott für alle Gottfernen zum gedemütigten Menschen wurde, bildet die Substanz der Verbundenheit mit der einen fernen biblischen Wahrheit. Dieser Gott hat sich den Menschen geschenkt, die wesentlich anders sind als er selbst. Auf diese Toleranz Gottes können Christen vertrauen.
4. In dieser Liebe des ganz anderen Gottes liegt die Hoffnung begründet, in ihr ist die Hoffnung verkörpert, dass ein neuer Anfang dem Menschen möglich ist, individuell wie historisch. Diese Hoffnung ist für die Christen existenziell.
5. Darin ist auch die Gewissheit verbürgt, dass der gedemütigte Mensch der Anerkennung durch Menschen bedarf, weil Gott sie ihm längst hat widerfahren lassen. Das Erbarmen ist christlich. Der Respekt vor dem anderen, der aus der begrenzten eigenen Auffassungsgabe erwächst, wird in der Welt der Gesellschaft politisch übersetzbar in den Begriff der Gerechtigkeit, die jedem widerfahren soll, der an der Schöpfungsintention Anteil hat.
Der jüdische Geschichtsphilosoph Walter Benjamin hat benannt, welches Geschenk diesem Gott zu verdanken ist: „Um der Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnung gegeben“. Was bräuchten Christen mehr?
Meine Überlegungen sind hiermit nun fast am Ende. Sie wollen vor allem eines sagen: Das europäische Erbe und das Christentum, die Tradition der Aufklärung, diejenige der Freiheit des Gewissens und des Pluralismus sind nicht voneinander zu sondern. In dieser Verknüpfung liegt vielmehr ihre gewinnende Kraft, liegt ihr Reichtum, dessen Anziehungskraft nicht verbraucht ist. Er lädt zur Neugier ein und nicht nur diejenigen, die in diesem Kulturkreis groß geworden sind. In der Geschichte der Toleranz begegnen, bereichern und korrigieren diese Traditionen einander und schulen die Wahrnehmung von Konflikten ebenso wie die Übung der Vernunft. Sie üben uns in den Plural der europäischen Kulturen ein, lehren uns, den Anderen anzuerkennen und zeigen uns eine vielfältige Moderne, die uns mit den anderen Bürgern der Welt aufs engste verflicht. Toleranz ist vor diesem Horizont ein Prozess. „Navigating the differences“, so hat der polnische Soziologe Zygmunt Bauman diesen Prozess beschrieben, und als ein Steuermann dieses Prozesses wird die Kirche dringend gebraucht. Glaubensfestigkeit hat in dieser Geschichte und in dem künftigen Prozeß der Vielfalt ihren Ursprung und ihr Ziel und lässt sich doch nicht in den Relativismus locken.
Die Kirche hat daher, so meine ich, eine doppelte Aufgabe: Sie soll uns, gut europäisch, dezidiert beim Relativieren und Differenzieren helfen, das heißt, die Kulturabhängigkeit von Überzeugungen erkennbar machen, also auch ihre eigene Heimat in der europäischen Geschichte kenntlich machen. Aber sie soll zugleich ebenso dezidiert beim Konturieren helfen, das heißt, das genuin Christliche, das genuin Protestantische erkennbar machen, um es öffentlich deutlich, streitbar und auch anerkennenswert werden zu lassen, übrigens auch tolerierbar. Nicht in der ängstlichen Abgrenzung gegenüber den anderen liegt dabei die wichtigste Aufgabe, sondern im selbstbewussten Darbieten des Eigenen, nicht in der Abwertung des Anderen, sondern, ganz wie Lessings Nathan es uns nahegelegt hat, im Vertrauen darauf, dass die Stärken des anderen nur wahrnehmen kann, wer seine eigenen Stärken kennt und den anderen an ihnen in Gottes Namen teilhaben lässt.
Die Kirche hätte also die doppelte Aufgabe, sowohl die Wahrnehmung und das Urteil zu schärfen als auch das Erbarmen spürbar werden zu lassen, das ein Rechtstaat nicht aufbringen kann. Ich stelle mir Schulen, Elternhäuser, Redaktionen, aber eben vor allem auch Gotteshäuser vor, in denen, ermuntert durch die Kirche, die Geschichte des Gekreuzigten überzeugend von der Philosophie eines John Locke, eines Voltaire, eines Goethe unterschieden wird, in denen das Edikt von Nantes ebenso wie seine Widerrufung bekannt sind. Ich stelle mir einen konziliaren Prozess der europäischen protestantischen Kirchen vor, der die Religions- und Säkularisationsgeschichte kultur-vergleichend ins Auge fasst.
Die protestantischen Kirchen in Deutschland hätten, trotz und wegen ihrer kulturellen Partikularität, den besonderen Auftrag, das Erbe der Reformation, die hier ihr Mutterland hat, selbstbewusst in den europäischen Toleranzgedanken hineinzutragen, ohne dabei der Individualisierung des Gewissens klare Kriterien für seine Grenzen schuldig zu bleiben. Zu diesem Erbe der Reformation gehört nicht zuletzt der Gedanke, dass alle ein Recht auf Bildung haben, dass keiner durch den Ausschluss von Wissen und Bildung verloren ist. Lesen können muss jeder. Die Kirche hätte sich dabei immer ihrer Trennung vom Staate bewusst zu bleiben und doch auch der Tatsache, dass ein Staat wie der unsere weltanschaulich nicht einfach neutral ist.
Ich möchte daher zum Schluss aufgreifen, was der polnische Publizist Stefan Wilkanowicz als Vorschlag zur Formulierung einer Präambel der europäischen Verfassung formuliert hat und zugleich weit darüber hinaus reicht und die Kirchen angeht:
„Wir Europäer wollen...
-
im Bewusstsein des Reichtums unseres Erbes, das aus den Errungenschaften des Judaismus, des Christentums, des Islam, der griechischen Philosophie und des römischen Rechts und des Humanismus, der sowohl religiöse als auch nicht-religiöse Quellen hat, schöpft,
-
im Bewusstsein des Wertes der christlichen Zivilisation, welche die Hauptquelle unserer Identität ist,
-
im Bewusstsein der häufigen Fälle von Verrat, der an diesen Werten von Christen und Nicht-Christen begangen wurde,
-
eingedenk des Guten und Bösen, das wir den Bewohnern anderer Kontinente gebracht haben
-
im Bedauern der Katastrophen, die durch totalitäre Systeme, die unserer Zivilisation entsprangen, verursacht wurden,
... unsere gemeinsame Zukunft bauen.“
Diese Formulierung bringt jene politisch wirksame Toleranz zum Ausdruck, die nicht gleichgültig ist und nicht blind anerkennend. Sie bettet die Christen ein in die plurale Zivilisation, in der sie ihren Glauben bekennen und bringt zum Ausdruck, dass die Toleranz sich auf Christen noch nicht lange leidlich verlassen kann. Sie gibt all denjenigen ein Zuhause unter Gleichen, die sich nicht zu Christus bekennen können und wollen. Sie fordert die Kirche auf, sich neugierig und selbstbewusst auf den offenen Weg der Verständigung zu begeben, auf dem viele schon vielsprachig unterwegs sind.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
07. November 2005